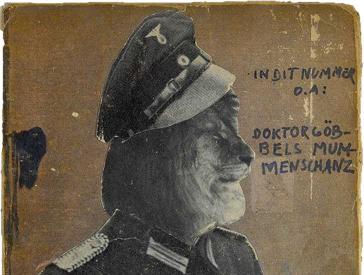Puzzleteile der Vergangenheit
Was wir bisher über eine Mesusa aus der Linienstraße 141 in Berlin-Mitte wissen
Dem Jüdischen Museum Berlin (JMB) werden regelmäßig Objekte angeboten. Oft wissen die Anbieter*innen oder vermuten es durch in der Familie tradierte Anspielungen, dass sie aus dem Eigentum jüdischer Familien stammen, die während der NS-Zeit verfolgt wurden. Die Gegenstände wurden entweder bei Haushaltsversteigerungen gekauft, dienten als Gegenleistung für Lebensmittel, wurden für jüdische Freund*innen angesichts der drohenden Deportation aufbewahrt oder in Wohnungen vorgefunden, aus denen zuvor jüdische Familien deportiert worden waren. Gerade wegen dieser problematischen und von ihren heutigen Besitzer*innen oft auch als belastend empfundene Erwerbsgeschichten wenden sich die Anbieter*innen an das Museum.
Das JMB sammelt solche Objekte nicht systematisch, hat sie jedoch in Ausnahmefällen als Dokumente der Verfolgung, der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit oder als Erinnerungen an die Verfolgten und Ermordeten angenommen. Heute bemühen wir uns gemeinsam mit den Anbieter*innen, die ursprünglichen Eigentümer*innen zu identifizieren und etwaige Erb*innen ausfindig zu machen, um eine Rückgabe zu ermöglichen. Gelingt dies nicht, bewahren wir die Gegenstände als Depositum auf – in der Hoffnung, in Zukunft weitere Erkenntnisse zu gewinnen.
 X
X
Mesusa aus der Linienstraße 141, 1880–1940, Metall, Papier, Tinte; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. L-2025/2, Foto: Roman März
Eine Mesusa als Kindheitsschatz
Ein solches Objekt ist die Mesusa aus der Linienstraße 141, deren Geschichte wir hier vorstellen möchten. Sie ist schlicht gearbeitet und deutet auf einen einfachen Haushalt hin. Sie wurde dem Museum von einem Berliner übergeben. Bis zum Frühjahr 1945 lebte seine Familie in der Linienstraße 125. Nachdem ihr Haus bei einem Bombenangriff zerstört wurde, erhielten sie eine Zweizimmerwohnung im ersten Stock des Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der Nummer 141. Die Wohnung stand leer, doch Nachbarn erzählten, dass dort bis 1943/44 eine jüdische Familie gelebt hatte, bevor sie deportiert wurde. Die Mesusa befand sich noch am Türpfosten der Eingangstür.
Was bedeutet Mesusa?
Mesusa (hebr. für Türpfosten), Plural Mesusot, Kapsel gefüllt mit einer Pergamentrolle, die Passagen aus der Tora enthält, wird am rechten Türpfosten als symbolischer Schutz befestigt
Von seiner Mutter und den Nachbarn wusste der damals noch kleine Junge, dass es sich um einen jüdischen Gegenstand handelte. Aus Neugier nahm er die Kapsel kurz nach Kriegsende ab und öffnete sie. Danach bewahrte er die Mesusa gemeinsam mit anderen Kindheitsschätzen in einer Dose auf, bis er sie Jahrzehnte später dem Museum übergab – mit dem Wunsch, dass sie nicht in Vergessenheit gerät.
Mit diesen Informationen begannen wir die Suche nach der jüdischen Familie, die bis zu ihrer Deportation hier gelebt hatte.
Jüdische Bewohner*innen der Linienstraße 141
Unsere Recherchen führten zunächst zur Datenbank Mapping the Lives, in der nach einstigen Wohnorten von Verfolgten des NS-Regimes gesucht werden kann. Die Suche ergab, dass 1939 sechs als jüdisch verfolgte Personen in der Linienstraße 141 lebten: die vierköpfige Familie Dagowitsch/Dagowitz und ihre beiden Untermieterinnen, die Schwestern Klein.
Ignatz Dagowitsch wurde 1888 in Jekaterinoslaw (heute Ukraine) geboren und kam vermutlich nach dem Ersten Weltkrieg nach Berlin. 1926 beantragte er hier einen Nansen-Pass, ein Reisedokument für staatenlose russische Flüchtlinge. In Berlin lernte er Feige Freiberg kennen, die 1902 in Jaroslau (heute Polen) geboren wurde und 1919 nach Berlin zog. Das Paar heiratete in den 1920er-Jahren, zunächst wohl nur religiös, denn die Ehe wurde erst 1936 standesamtlich eingetragen.
Die Dagowitschs hatten zwei Töchter: Susi Mary (geb. 1926) und Sulamith/Schula (geb. 1936). Ignatz arbeitete als Schneider, Feige handelte mit Textilien auf Märkten. Im Berliner Adressbuch sind sie ab 1931 unter der Adresse Linienstraße 141 verzeichnet, möglicherweise wohnten sie aber bereits seit 1925 dort. Bis zu ihrer Auswanderung 1933 lebte auch Feiges Schwester Bertha bei ihnen.
Ende 1938 oder Anfang 1939 zogen die Schwestern Fanny Klein (geb. 1885) und Johanna Breitenstein, geb. Klein (geb. 1883), als Untermieterinnen in die Wohnung der Dagowitschs. Beide wurden in Altenwalde (heute Polen) geboren. Fanny arbeitete als Angestellte, Johanna als Haushälterin. Eine weitere Schwester, Dora, lebte mit ihrem Mann David Hirsch, ebenfalls Schneider, in der nahegelegenen Linienstraße 130.
Am 1. November 1941 wurden alle sechs – Ignatz, Feige, Susi und Sulamith Dagowitsch sowie Fanny und Johanna Klein – nach Litzmannstadt deportiert. Digitalisierte Karteikarten der Berliner Finanzbehörden in den Arolsen Archives belegen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt noch in der Linienstraße 141 wohnten. Im Mai 1942 wurden sie nach Kulmhof verschleppt und dort ermordet.
Offene Fragen
Unklar bleibt, ob die Wohnung der Dagowitschs tatsächlich diejenige war, in die nach Kriegsende die Familie des Berliner Jungen zog, der die Mesusa fand. Nach dem Krieg reichten Feiges Geschwister Antrag auf Wiedergutmachung und Entschädigung für Feige und Ignatz Dagowitsch ein. Hier hielt Feiges Schwester Bertha fest:
„Ich selbst kam etwa 1925 nach Berlin und wohnte bei meiner Schwester in der Linienstr. 141 bis zu meiner erzwungenen Auswanderung im Jahre 1933. […] Mein Schwager war Schneider. Er hatte seine Werkstätte in der Wohnung. Die Wohnung meiner Schwester war gut bürgerlich eingerichtet und bestand aus 3 Zimmern.“
Auch eine weitere Verwandte von Feige, die 1934 auswanderte, erinnert sich an eine Drei-Zimmer-Wohnung:
„In einem Zimmer war die erwähnte Schneiderwerkstatt, und in den beiden anderen Zimmern wohnte die Familie Dagowitsch.“
Ist es denkbar, dass die Dagowitschs Ende der 1930er-Jahre in eine kleinere Wohnung innerhalb des Hauses zogen? Oder gehörte die Mesusa zur Wohnung einer anderen jüdischen Familie, die erst nach 1939 dort einzog?
Wer genau die Mesusa einst anbrachte, konnten wir bislang also nicht eindeutig klären. Falls Sie mehr über die Geschichte des Hauses wissen oder Nachfahren der Familie Dagowitsch sind, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden. Jede neue Information hilft, ein weiteres Puzzleteil der Vergangenheit zusammenzufügen. Bis dahin bewahren wir die Mesusa sorgfältig auf – als Zeugnis unterbrochener Leben und in der Hoffnung, sie eines Tages doch noch an Nachfahren zurückgeben zu können.
Elisabeth Weber, Provenienzforscherin am JMB
Blick hinter die Kulissen: Provenienzforschung am JMB (4)