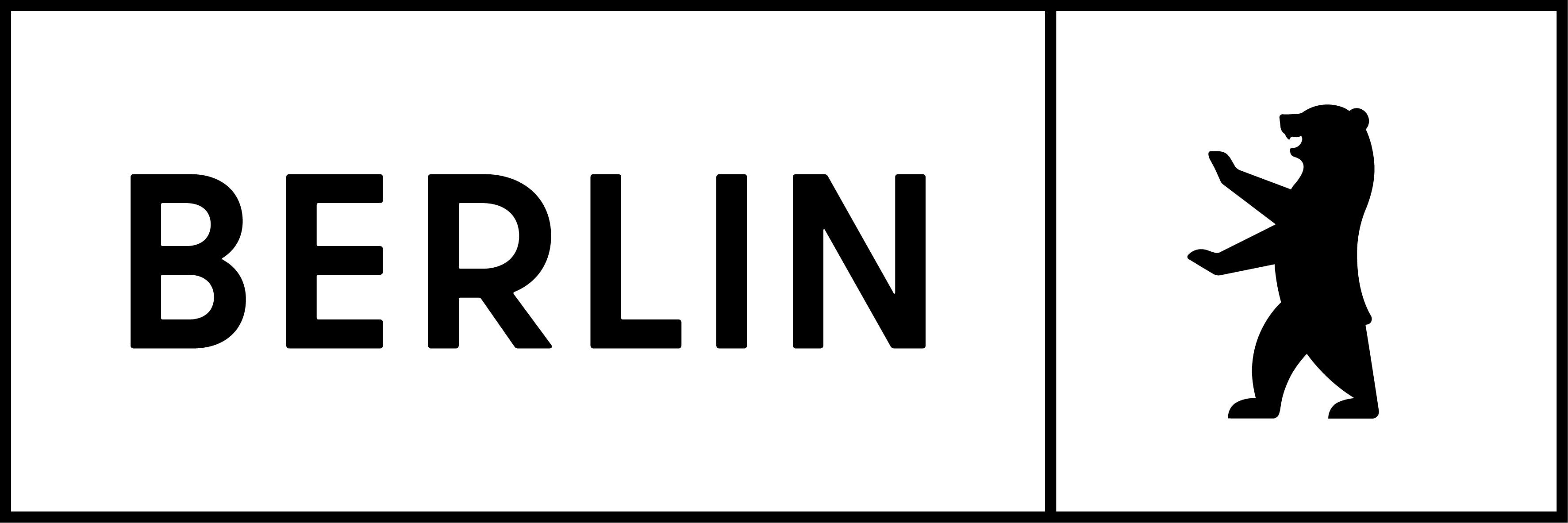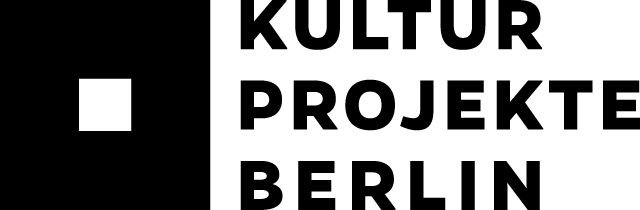Wer weiß, wer kennt: Das Amt für Verwandtensuche
Hörspiel und Gespräch mit den Autoren Noam Brusilovsky und Ofer Waldman anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus

Amt für Verwandtensuche; Foto: Central Zionist Archive
„Das Amt für Verwandtensuche erreichten Nachrichten und Grußbestellungen von Verwandten und Freunden aus dem Land und aus der Welt.“
Mit diesen Worten begann dreimal wöchentlich die Radiosendung Wer weiß, wer kennt, die ab 1945 im Sender Kol Yerushalayim (Die Stimme Jerusalems, später Kol Israel) mit einer internationalen Reichweite ausgestrahlt wurde. Die Sendung diente der Suche von Vermissten und Verschollenen, deren Spuren sich im Holocaust verloren hatten und die nach Kriegsende von Verwandten gesucht wurden.
So, 11. Mai 2025, 16 Uhr

Wo
W. M. Blumenthal Akademie,
Klaus Mangold Auditorium
Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 1, 10969 Berlin
(gegenüber dem Museum)
Die Autoren Noam Brusilovsky und Ofer Waldman haben mit ihrem einstündigen Hörspiel die Originalsendung anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs rekonstruiert. Das Hörspiel basiert auf historischen Sendemanuskripten in Deutsch, Jiddisch, Englisch und Hebräisch, die sich im Zionistischen Archiv in Jerusalem befinden.
In Kooperation mit dem rbb präsentierten wir das Hörspiel und sprechen mit dem Autorenduo Noam Brusilovsky und Ofer Waldman über die ungewöhnliche Recherche und Produktion.
Die Veranstaltung ist Teil der stadtweiten Themenwoche 80 Jahre Kriegsende – Befreiung Europas vom Nationalsozialismus, auf Initiative und gefördert vom Land Berlin, realisiert von Kulturprojekte Berlin mit zahlreichen Partnern. In Kooperation mit dem rbb.
Mehr zur historischen Sendung Wer weiß, wer kennt
Mit Ende des Zweiten Weltkriegs galten europaweit Millionen von Soldaten und Zivilisten als vermisst. In Deutschland allein war im Mai 1945 jede vierte Person ein Suchender oder eine Gesuchte. Das Chaos nach Krieg, Flucht und Vertreibung war unüberschaubar. Seit Ende 1945 sendeten auch die deutschsprachigen Rundfunkstationen Suchmeldungen – oft direkt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz. Die Suche nach jüdischen Überlebenden lief über andere Kanäle und stellte sich als besonders schwierig heraus. Sie waren oft staatenlos als Displaced Persons (DPs) in Lagern über ganz Europa verteilt und von der Feindseligkeit ihrer einstigen nichtjüdischen Umgebung an eine Rückkehr in die Heimat gehindert. Bis tief ins Jahr 1946 gab es Pogrome gegen rückkehrende Jüdinnen und Juden. Auch häufig als einzige Überlebende von fast gänzlich ausgelöschten Gemeinden, war die Rolle jüdischer Überlebender als Suchende bzw. Gesuchte äußerst prekär. Mehrere Hilfsorganisationen aus Europa, den USA sowie des jüdischen Gemeinwesens in Palästina beteiligten sich nach Kriegsende an der Koordinierung dieser Suchaktion und stellten gemeinsam Listen von Überlebenden her.
Bis heute spielt die Sendung Wer weiß, wer kennt eine zentrale Rolle in der Darstellung der Holocausterinnerung in Israel. Für viele Israelis bot die Sendung, die dreimal wöchentlich nach den Mittagsnachrichten ausgestrahlt wurde, einen ersten, unmittelbaren Einblick in die Lebensrealität vieler Holocaustüberlebender. Für die Überlebenden selbst wie auch für deren Familien, läutete das Ende des Zweiten Weltkriegs eine existenzielle Krise ein: Im Schatten des kollektiven Verlusts des jüdischen Volkes mussten sie den Verlust der eigenen engen Kreise verarbeiten. Dazu gesellte sich, nicht minder erschütternd, die Tortur der Ungewissheit über das Schicksal von Verwandten und Freund*innen. Der Alltag im jungen israelischen Staat, der von Krieg und Not gekennzeichnet war, ließ darüber hinaus wenig Platz für Trauer übrig. So etablierte sich die Sendung Wer weiß, wer kennt als privater und kollektiver Erinnerungsort.
Ermöglicht durch