
Kunstautomat
2013 bis 2018
Hochwertige Fotoabzüge, bedruckte Stoffe oder kleine Skulpturen: Der Kunstautomat des Jüdischen Museums Berlin offerierte von August 2013 bis Juni 2018 temporär in seinen 30 Fächern ein breites Spektrum überraschender Gegenwartskunst. Die kleinformatigen Unikate wurden von internationalen jüdischen Künstler*innen geschaffen, die in Berlin leben. Alle Kunstwerke wurden exklusiv für den Automaten kreiert, handsigniert und existierten nur in limitierter Auflage.
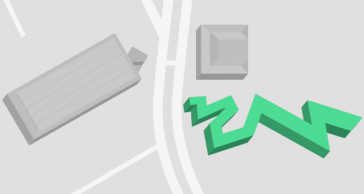
Wo
Libeskind-Bau EG, Eric F. Ross Galerie
Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin
Gegenwartskunst für 6 Euro
Für 6 € (zu zahlen in drei Zweieuromünzen) konnten sich Besucher*innen ein Stück Gegenwartskunst aus dem Automaten ziehen.
Bei dem Automaten, der sich auf der Hälfte des Rundgangs durch die frühere Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin befand, handelte es sich um einen umgebauten und neu gestalteten Warenautomaten aus den 1970er-Jahren.
Werke und Künstler*innen
Folgende Künstler*innen nahmen am Projekt teil:
April–Dezember 2016
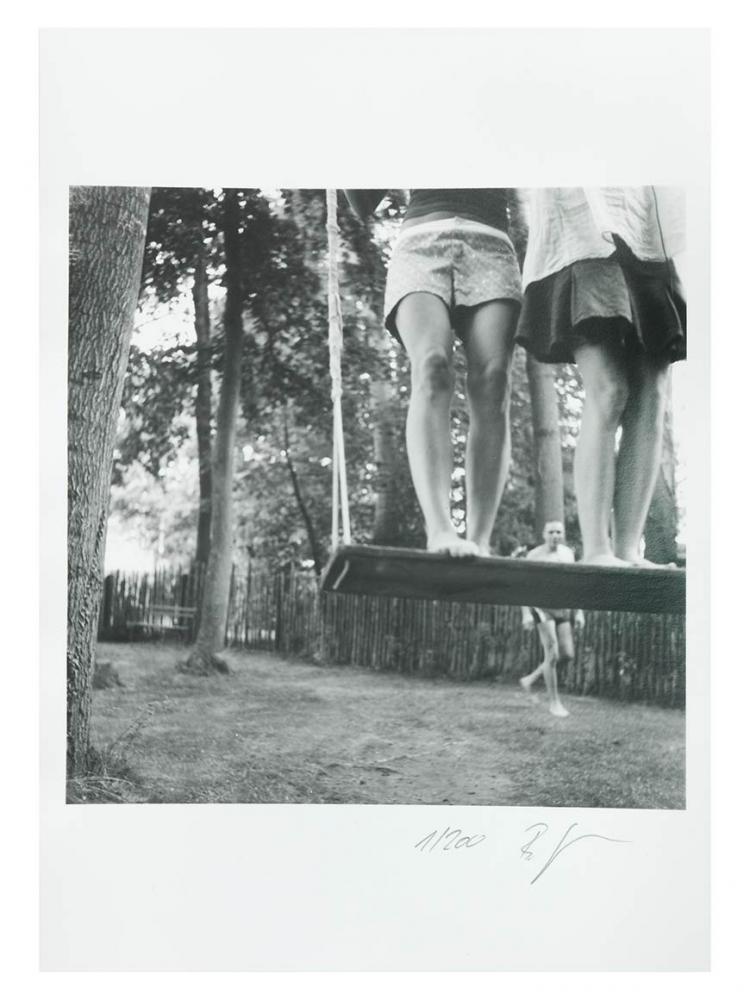
Birgit Naomi Glatzel (*1970, Kempten, Deutschland), Angela and Me, Fotoprojekt You and Me; Jüdisches Museum Berlin.
Freundschaften über sechzehn Ecken und ein Kamel auf Weltreise
Es ist ein warmer Tag im Sommer 2016, als ich Birgit Glatzel im Prenzlauer Berg besuche. So ähnlich muss das Wetter an dem Tag gewesen sein, an dem ihre Fotografie Angela and Me entstanden ist, die ebenso wie ihr Kurzfilm Going to Jerusalem in unserem Kunstautomaten zu erwerben war.
Angela und Birgit
Angela and Me ist Teil einer Serie, in der sich die Künstlerin per Selbstauslöser mit Freund*innen porträtiert. Alle Aufnahmen entstehen mit einer Rolleiflex-Kamera von 1937, Ort und Situation werden stets gemeinsam ausgewählt. Begonnen hat Birgit mit dem Projekt kurz vor ihrer Auswanderung nach Israel 2007; dorthin wollte sie Erinnerungsfotos an ihre Freund*innen in Deutschland mitnehmen. „Die Erinnerung hat im Judentum einen hohen Stellenwert, auch in einer renovierten Wohnung lässt man zum Beispiel immer ein Stück Original“
, erklärt mir die Künstlerin, die gelernte Architektin ist und, um sich zu finanzieren, weiterhin als solche arbeitet.
Bevor ich mit Birgit über ihre Kunst spreche, zeigt sie mir ihr Wohnatelier, wo sie mit ihrem Sohn lebt, seit sie nach Berlin zurückgekehrt ist. Ich bin begeistert von den verschiebbaren Wänden, hinter denen sich das Badezimmer der großen Einraumwohnung verstecken lässt. Dann erzählt Birgit mir, dass Angela and Me sie gemeinsam mit ihrer Freundin Angela zeige, deren Geburtstag sie im Sommer 2014 zu zweit am Müggelsee feierten. Zu sehen sind jedoch nur die Beine der beiden Frauen, die auf einer Schaukel stehen, sowie bei genauerem Hinsehen ein Mann im Hintergrund, der direkt in die Kamera blickt.
„Stört es dich eigentlich, dass da einfach jemand in euer Bild gelaufen ist?“
, frage ich Birgit. Nein, der gehöre dazu, weil er den Zufall und den Überraschungseffekt zeige, den der verzögerte Selbstauslöser bedingt. „Ich wusste schon im Moment der Aufnahme, dass es das Foto geworden ist.“
„Und was sagst du dazu, dass dein privates Erinnerungsfoto nun bei anderen Leuten zu Hause hängt?
„Diese unkontrollierbare Zerstreuung meiner Kunstwerke finde ich toll. Und da unsere Gesichter nicht zu sehen sind, ist es gleichzeitig anonym genug.“
Für die Foto-Serie gibt es mittlerweile schon eine Warteliste, weitere Freund*innen wollen Teil des Projekts werden.
Jerusalem im Eisfach
Auch bei anderen Projekten arbeitet Birgit Glatzel am liebsten mit einem*einer Partner*in, denn so entstehen die besten Ideen. So war es auch bei dem Kunstfilm Going to Jerusalem, den sie gemeinsam mit dem Animations-Filmemacher Benjamin Seide gedreht hat. Er entstand bereits vor zehn Jahren als Beitrag zu einer Ausstellung in Jerusalem mit dem Thema Land(e)scaping. Benjamin und Birgit wollten darin die fünftausendjährige, komplexe Geschichte Jerusalems auf unterhaltsame Weise thematisieren, ohne sie lächerlich zu machen.
Die Idee gab schließlich eine Schneekugel mit einer Stadtsilhouette von Jerusalem und einem Kamel, die Birgit von einer Freundin, Hagar aus Israel, geschenkt bekommen hatte: Die beiden beschlossen, die Silhouette der Stadt aus ihrer Schneekugel zu „befreien“ und sie in Begleitung des Kamels auf „Weltreise“ zu schicken. Dafür zerstörten sie die Schneekugel und nutzen die beiden Motive als „Hauptdarsteller“ für ihren Film. Drehorte waren unter anderem das Eisfach von Birgits Kühlschrank sowie die Baustelle auf dem Spielplatz gegenüber ihrer Wohnung. „Seltsamerweise hat in Israel niemand über den Film gelacht, obwohl er so absurd ist – man sieht zum Beispiel das Kamel in einer Seilbahn in den Alpen schwebend“
, wundert sich Birgit. „Deine Kollegin Gelia Eisert war die erste, die den Film lustig fand.“
„Ich habe auch sehr gelacht,“
kann ich Birgit beruhigen.
Da der Film nach der Ausstellung in Jerusalem nur ein weiteres Mal öffentlich gezeigt wurde, hat die Künstlerin ihn für sein Weiterleben schließlich auf einem USB-Stick in unseren Kunstautomaten gesteckt. Aufgeklebt war der Stick auf eine Postkarte, die das Kamel in der Seilbahn zeigt. In liebevoller Handarbeit ist die Karte mit Kamelköpfen bestempelt, die Benjamin Seide und Birgit Glatzel selbst gestaltet haben. „Die Arbeit mit Benjamin war ein großer Spaß“
, lacht Birgit, „das war eine charmante und ganz besondere Zusammenarbeit, bei der Filmproduktion und genauso viele Jahre später beim Gestalten der Karten. Leider war das bisher unser einziges gemeinsames Projekt.“
A Friend is a Friend of a Friend
Ganz besonders am Herzen liegt Birgit Glatzel immer noch ihr erstes großes Langzeitprojekt, in dem sich die beiden Motive aus den anderen Kunstwerken wiederfinden: Freundschaft und Reisen. Dafür kam zum ersten Mal die Rolleiflex zum Einsatz – ihre Kamera für besondere Gelegenheiten: Ein Foto kostet etwa 2 Euro, da überlegt man zweimal, ob man auf den Auslöser drückt. Für A Friend is a Friend of a Friend schickte sich Birgit vier Jahre lang selbst auf Reisen und besuchte auf der ganzen Welt erst Freund*innen, dann Freund*innen dieser Freund*innen und so weiter, insgesamt 340 Menschen teilweise bis ins sechzehnte „Freundschaftsglied“. „Ich wollte damit vorleben, dass man es anders machen kann und dass das Internet nicht das persönliche Erlebnis ersetzt.“
Ein Zufallsfund führt um die Welt
Von allen Freund*innen und deren Freund*innen, die Birgit Glatzel traf und bei denen sie zuweilen übernachtete, machte sie ein Foto mit ihrer Rolleiflex. Die Kamera war dabei immer ein guter Einstieg für ein erstes Treffen mit den meist fremden Leuten: „Es ist ein Element, das alle kennen, gleichzeitig kann man damit unauffälliger Fotos machen, das schüchtert nicht so ein.“
Die Rolleiflex war ein Zufallsfund: „Ich wollte schon immer eine solche Kamera haben und als ich auf der Suche nach einem Blitz für einen anderen Fotoapparat war, habe ich sie entdeckt.“
Das Fotoprojekt mündete in eine Ausstellung und viele Jahre später in ein Buch, das Birgit Glatzel mit einer mehrmonatigen Crowdfunding-Kampagne finanzierte. Darin sind Fotos von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt in ihrem privaten Umfeld zu sehen. Im Anhang listet eine Tabelle alle Abgebildeten auf, sortiert nach Wohnort, Beruf oder „Freundschaftsclan“, wie Birgit es nennt.
Zum Abschluss darf auch ich einmal durch die Rolleiflex schauen. „Man sieht alles spiegelverkehrt“
, sagt Birgit, „aber es fällt mir gar nicht mehr auf.“
Außerdem schenkt sie mir ein Exemplar von A Friend is a Friend of a Friend, Nummer 184 von 300, handsigniert, als Erinnerung an den gemeinsamen Nachmittag in Birgits Atelier, der wie im Flug vergangen ist. Das Buch liegt nun auf meinem Schreibtisch und erinnert mich daran, dass man sich viel öfter selbst auf Reisen schicken sollte oder Freund*innen besuchen oder Menschen treffen, die man (noch) nicht kennt.
Mariette Franz, Digital & Publishing
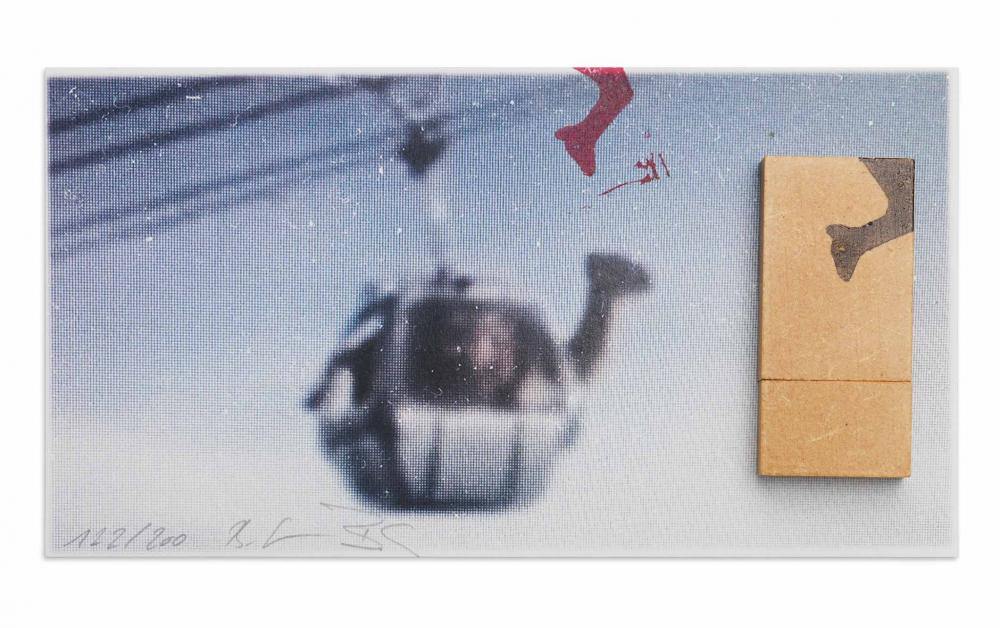
Birgit Naomi Glatzel (*1970, Kempten, Deutschland) & Benjamin Seide (* 1968, Frankfurt am Main, Deutschland), Going to Jerusalem; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Freundschaften über sechzehn Ecken und ein Kamel auf Weltreise
Es ist ein warmer Tag im Sommer 2016, als ich Birgit Glatzel im Prenzlauer Berg besuche. So ähnlich muss das Wetter an dem Tag gewesen sein, an dem ihre Fotografie Angela and Me entstanden ist, die ebenso wie ihr Kurzfilm Going to Jerusalem in unserem Kunstautomaten zu erwerben war.
Angela und Birgit
Angela and Me ist Teil einer Serie, in der sich die Künstlerin per Selbstauslöser mit Freund*innen porträtiert. Alle Aufnahmen entstehen mit einer Rolleiflex-Kamera von 1937, Ort und Situation werden stets gemeinsam ausgewählt. Begonnen hat Birgit mit dem Projekt kurz vor ihrer Auswanderung nach Israel 2007; dorthin wollte sie Erinnerungsfotos an ihre Freund*innen in Deutschland mitnehmen. „Die Erinnerung hat im Judentum einen hohen Stellenwert, auch in einer renovierten Wohnung lässt man zum Beispiel immer ein Stück Original“
, erklärt mir die Künstlerin, die gelernte Architektin ist und, um sich zu finanzieren, weiterhin als solche arbeitet.
Bevor ich mit Birgit über ihre Kunst spreche, zeigt sie mir ihr Wohnatelier, wo sie mit ihrem Sohn lebt, seit sie nach Berlin zurückgekehrt ist. Ich bin begeistert von den verschiebbaren Wänden, hinter denen sich das Badezimmer der großen Einraumwohnung verstecken lässt. Dann erzählt Birgit mir, dass Angela and Me sie gemeinsam mit ihrer Freundin Angela zeige, deren Geburtstag sie im Sommer 2014 zu zweit am Müggelsee feierten. Zu sehen sind jedoch nur die Beine der beiden Frauen, die auf einer Schaukel stehen, sowie bei genauerem Hinsehen ein Mann im Hintergrund, der direkt in die Kamera blickt.
„Stört es dich eigentlich, dass da einfach jemand in euer Bild gelaufen ist?“
, frage ich Birgit. Nein, der gehöre dazu, weil er den Zufall und den Überraschungseffekt zeige, den der verzögerte Selbstauslöser bedingt. „Ich wusste schon im Moment der Aufnahme, dass es das Foto geworden ist.“
„Und was sagst du dazu, dass dein privates Erinnerungsfoto nun bei anderen Leuten zu Hause hängt?
„Diese unkontrollierbare Zerstreuung meiner Kunstwerke finde ich toll. Und da unsere Gesichter nicht zu sehen sind, ist es gleichzeitig anonym genug.“
Für die Foto-Serie gibt es mittlerweile schon eine Warteliste, weitere Freund*innen wollen Teil des Projekts werden.
Jerusalem im Eisfach5
Auch bei anderen Projekten arbeitet Birgit Glatzel am liebsten mit einem*einer Partner*in, denn so entstehen die besten Ideen. So war es auch bei dem Kunstfilm Going to Jerusalem, den sie gemeinsam mit dem Animations-Filmemacher Benjamin Seide gedreht hat. Er entstand bereits vor zehn Jahren als Beitrag zu einer Ausstellung in Jerusalem mit dem Thema Land(e)scaping. Benjamin und Birgit wollten darin die fünftausendjährige, komplexe Geschichte Jerusalems auf unterhaltsame Weise thematisieren, ohne sie lächerlich zu machen.
Die Idee gab schließlich eine Schneekugel mit einer Stadtsilhouette von Jerusalem und einem Kamel, die Birgit von einer Freundin, Hagar aus Israel, geschenkt bekommen hatte: Die beiden beschlossen, die Silhouette der Stadt aus ihrer Schneekugel zu „befreien“ und sie in Begleitung des Kamels auf „Weltreise“ zu schicken. Dafür zerstörten sie die Schneekugel und nutzen die beiden Motive als „Hauptdarsteller“ für ihren Film. Drehorte waren unter anderem das Eisfach von Birgits Kühlschrank sowie die Baustelle auf dem Spielplatz gegenüber ihrer Wohnung. „Seltsamerweise hat in Israel niemand über den Film gelacht, obwohl er so absurd ist – man sieht zum Beispiel das Kamel in einer Seilbahn in den Alpen schwebend“
, wundert sich Birgit. „Deine Kollegin Gelia Eisert war die erste, die den Film lustig fand.“
„Ich habe auch sehr gelacht,“
kann ich Birgit beruhigen.
Da der Film nach der Ausstellung in Jerusalem nur ein weiteres Mal öffentlich gezeigt wurde, hat die Künstlerin ihn für sein Weiterleben schließlich auf einem USB-Stick in unseren Kunstautomaten gesteckt. Aufgeklebt war der Stick auf eine Postkarte, die das Kamel in der Seilbahn zeigt. In liebevoller Handarbeit ist die Karte mit Kamelköpfen bestempelt, die Benjamin Seide und Birgit Glatzel selbst gestaltet haben. „Die Arbeit mit Benjamin war ein großer Spaß“
, lacht Birgit, „das war eine charmante und ganz besondere Zusammenarbeit, bei der Filmproduktion und genauso viele Jahre später beim Gestalten der Karten. Leider war das bisher unser einziges gemeinsames Projekt.“
A Friend is a Friend of a Friend
Ganz besonders am Herzen liegt Birgit Glatzel immer noch ihr erstes großes Langzeitprojekt, in dem sich die beiden Motive aus den anderen Kunstwerken wiederfinden: Freundschaft und Reisen. Dafür kam zum ersten Mal die Rolleiflex zum Einsatz – ihre Kamera für besondere Gelegenheiten: Ein Foto kostet etwa 2 Euro, da überlegt man zweimal, ob man auf den Auslöser drückt. Für A Friend is a Friend of a Friend schickte sich Birgit vier Jahre lang selbst auf Reisen und besuchte auf der ganzen Welt erst Freund*innen, dann Freund*innen dieser Freund*innen und so weiter, insgesamt 340 Menschen teilweise bis ins sechzehnte „Freundschaftsglied“. „Ich wollte damit vorleben, dass man es anders machen kann und dass das Internet nicht das persönliche Erlebnis ersetzt.“
Ein Zufallsfund führt um die Welt
Von allen Freund*innen und deren Freund*innen, die Birgit Glatzel traf und bei denen sie zuweilen übernachtete, machte sie ein Foto mit ihrer Rolleiflex. Die Kamera war dabei immer ein guter Einstieg für ein erstes Treffen mit den meist fremden Leuten: „Es ist ein Element, das alle kennen, gleichzeitig kann man damit unauffälliger Fotos machen, das schüchtert nicht so ein.“
Die Rolleiflex war ein Zufallsfund: „Ich wollte schon immer eine solche Kamera haben und als ich auf der Suche nach einem Blitz für einen anderen Fotoapparat war, habe ich sie entdeckt.“
Das Fotoprojekt mündete in eine Ausstellung und viele Jahre später in ein Buch, das Birgit Glatzel mit einer mehrmonatigen Crowdfunding-Kampagne finanzierte. Darin sind Fotos von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt in ihrem privaten Umfeld zu sehen. Im Anhang listet eine Tabelle alle Abgebildeten auf, sortiert nach Wohnort, Beruf oder „Freundschaftsclan“, wie Birgit es nennt.
Zum Abschluss darf auch ich einmal durch die Rolleiflex schauen. „Man sieht alles spiegelverkehrt“
, sagt Birgit, „aber es fällt mir gar nicht mehr auf.“
Außerdem schenkt sie mir ein Exemplar von A Friend is a Friend of a Friend, Nummer 184 von 300, handsigniert, als Erinnerung an den gemeinsamen Nachmittag in Birgits Atelier, der wie im Flug vergangen ist. Das Buch liegt nun auf meinem Schreibtisch und erinnert mich daran, dass man sich viel öfter selbst auf Reisen schicken sollte oder Freund*innen besuchen oder Menschen treffen, die man (noch) nicht kennt.
Mariette Franz, Digital & Publishing
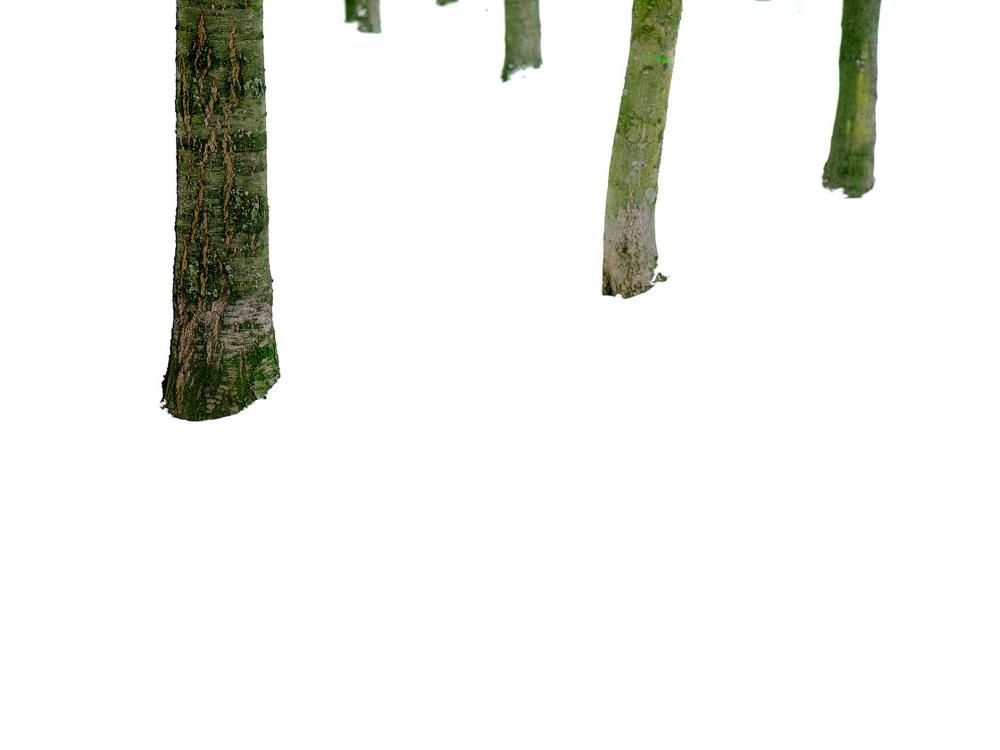
Daniela Orvin (*1973, Berlin, Deutschland), Dyslexic Dysgraphia, 2006, Edition 2015; Jüdisches Museum Berlin.
Treiben im weißen Nichts
Dyslexic Dysgraphia. Die Fotografien der israelischen Künstlerin Daniela Orvin, die wir ab April 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin anboten, haben einen schwer verständlichen Titel. Er bedeutet: legasthenische Schreibstörung. „Jedes meiner Werke ist ein Selbstporträt
“, sagt die Fotografin und Musikerin, als ich sie an einem sonnigen Nachmittag in ihrer Atelierwohnung in Berlin-Friedrichshain besuche. Sie selbst leidet an einer Leseschwäche, die erst erkannt wurde, als sie schon 29 Jahre alt war – und nach eigener Aussage zu einiger Desorientierung in ihrem Leben führte.
Die Leere auf meinen Fotos
Legt man die Fotografien der Werkserie Dyslexic dysgraphia nebeneinander, so sehen sie aus wie die Zeichen einer fremden, seltsamen Sprache. Tatsächlich zeigen sie Baumstämme im Schnee. Daniela Orvin hat sie zwischen 2004 und 2006 in einem Park in München aufgenommen. Es war für sie wesentlich, den Schnee ohne Schattierungen abzubilden, und so treiben die Stämme scheinbar wurzellos und isoliert in einer makellos weißen Landschaft.
Für den Kunstautomaten hat Daniela Orvin die Fotografien in Acrylglasrahmen montiert – und fühlt sich durch diese behutsame Arbeit jedem der Bilder verbunden. Auf die Frage, was die Essenz ihrer Kunst sei, antwortet sie: „Die Leere auf meinen Fotos.
“ Einsamkeit, Entwurzelung und die Schwierigkeit, sich mit anderen zu verständigen, scheinen in ihrem Werk immer wieder auf.
Die Sprache hatte sich schlafen gelegt
1973 in Berlin geboren, wuchs die Künstlerin bis zu ihrem siebten Lebensjahr in Ismaning auf, einem kleinen Ort nahe München. Dann zog die Familie nach Israel, wo Daniela Orvin fortan den größten Teil ihres Lebens verbrachte: Sie ging dort zur Schule und zur Armee, studierte an der renommierten Midrasha-Kunstschule in Beit Berl, war Mitbegründerin und Kuratorin einer Galerie für zeitgenössische Fotografie in Tel Aviv und zeigte ihre Kunst in eigenen Ausstellungen. Aber wirklich zugehörig fühlte sie sich nicht. In den ersten Jahren in Israel erfuhr sie viel Ablehnung von anderen Kindern, die sie als „die Deutsche“ sahen. Dieses Gefühl der Fremdheit hat sie auch später nicht verlassen.
2012 zog Daniela Orvin von Tel Aviv in ihre Geburtsstadt Berlin zurück. Deutsch ist ihre Muttersprache, aber sie muss sie neu lernen. „Die Sprache hatte sich lediglich schlafen gelegt
“, sagt sie, und so kann sie auf die Erinnerung an ihre Kindersprache zurückgreifen. In Berlin findet sie die innere Ruhe, die sie braucht, um arbeiten zu können. Erfahrungen und Begegnungen, die Natur und das Wetter inspirieren sie zu ihrer Kunst. Am meisten liebt sie die intuitiven Aspekte ihrer Arbeit, die Versuche, zum Wesentlichen eines neuen Werkes zu gelangen, und das Fotografieren selbst.
Dressur-Wunder
Klare Linien, Ruhe und Licht, Schwarz und Weiß kennzeichnen Daniela Orvins Atelierwohnung. Dort zeigt sie mir den Fotoband Dressur-Wunder. Die Bilder, die er enthält, sind zwischen 2007 und 2009 im Zoologischen Garten in Berlin und im Zirkus Krone in München entstanden. Orvin greift damit Kindheitserinnerungen auf, denn dort war sie als Mädchen mit ihren Eltern. Die Freude der Zoo- und Zirkusbesucher bleibt ausgespart. Vielmehr sehen wir auf den dunklen Fotografien, wie allein und verloren sich die Tiere (und Artisten) in der ihnen fremden Umgebung bewegen. Die Aufnahmen sind ruhig, distanziert und präzise – wie die Künstlerin selbst.
Maren Krüger, Ausstellungen
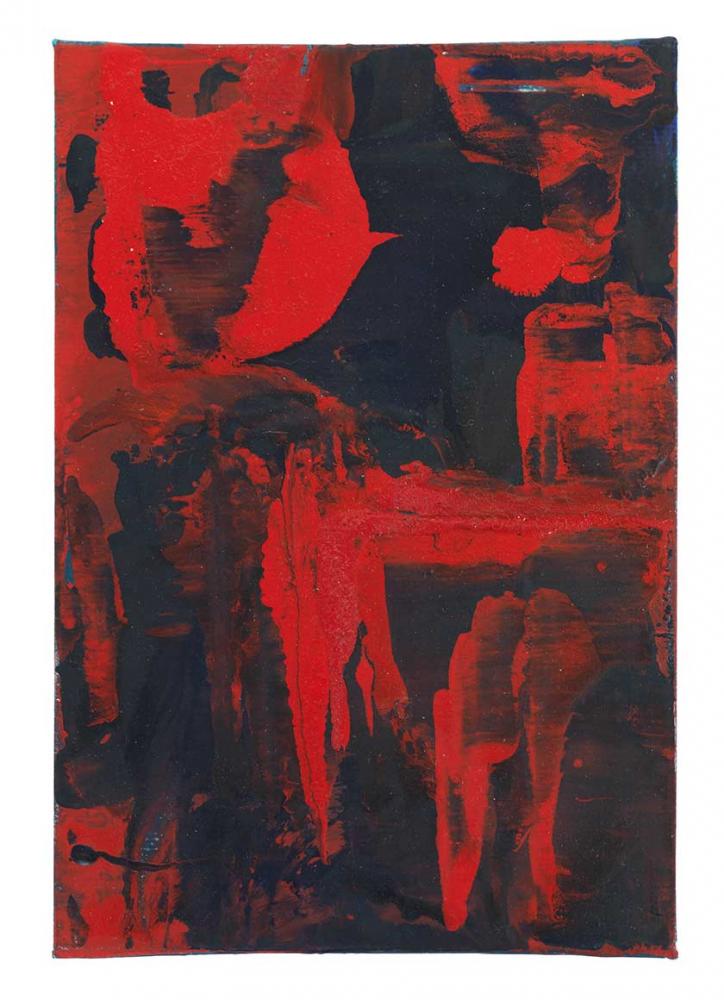
David Benforado (*1977, Athen, Griechenland), Abstrakte Stücke aus der Serie Makams Malen, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe
Musik Malen
„So wie sich eine ganze Welt in fünf Tönen auftut, so eröffnet sich eine ganze Welt in fünf Farben.“
Mit diesen Worten beschreibt David Benforado, Maler und Musiker zugleich, sein Verständnis von Kunst. Makams Malen und Zwischen Klang und Stille lauten dementsprechend auch die Titel der beiden Serien, die ab 2016 im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin zu erwerben waren. Musik und Malerei verbinden sich in den kleinformatigen Ölbildern zu abstrakten Farbstudien voller Kraft und Energie.
Seit er malt, arbeitet David Benforado mit Musik. Immer wieder fanden in seinem Atelier Sessions mit professionellen Musikern statt, so zum Beispiel während seiner Zeit in Budapest mit dem Akkordeonisten David Yengiburgan oder später in Berlin mit dem Pianisten Antonis Anissegos. 2009 begann Benforado mit dem Studium der orientalischen Nay-Flöte und entdeckte für sich die Welt der Makams und modalen Musik des östlichen Mittelmeerraums. Sie ist eine Quelle der Inspiration für seine Malerei geworden.
Das Licht auf Syros
David Benforado wuchs in Griechenland auf. Das besondere Licht dieser Region ist, wie er sagt, „ein Teil von mir“
. Besonders prägend für den Künstler war ein zweijähriger Aufenthalt auf der griechischen Insel Syros im Mittelmeer. Im Rhythmus der Tage und Jahreszeiten beobachtete und analysierte er das Licht in all seinen Schattierungen und Wandlungen und entwickelte eine veränderte Wahrnehmung der Farben sowie neue Wege ihrer Verwendung.
Bei den je 200 Ölbildern der beiden Serien für den Kunstautomaten, jedes für sich ein Unikat, verwendete der Künstler beim Malen zwei unterschiedliche Techniken. Seine Farben mischte er, wie immer, aus Pigmenten selbst: In der ersten Variante legte er mehrere Farbschichten nach und nach übereinander. Zwischenzeitlich trockneten die Farben, die letzte Schichtung erfolgte nach der Methode „nass auf nass“. In der zweiten Variante erfolgte der Farbauftrag in einem Schwung, verbunden mit dem Hören von modaler Musik. Die dieser Musik zugrundeliegenden Makams – Tonfolgen, die jeweils durch bestimmte Intervalle und einen charakteristischen Melodieverlauf gekennzeichnet sind – stehen jeweils für unterschiedliche Affekte. Jedes Bild überträgt das Timbre und die Klangfarbe eines spezifischen Makams. Diese Werke sind Studien für größere Gemälde.
Die Bilder Benforados rufen Assoziationen an die Natur hervor: Wogen, Wellen, Feuer, Wind, das Rauschen von Blättern, Sonnenlicht und Himmel. Jedes von ganz eigenem Charakter, laden sie zu meditativer Versenkung ein und dazu, zu entdecken, was sich hinter ihrer Oberfläche befindet.
Leonore Maier, Sammlungen
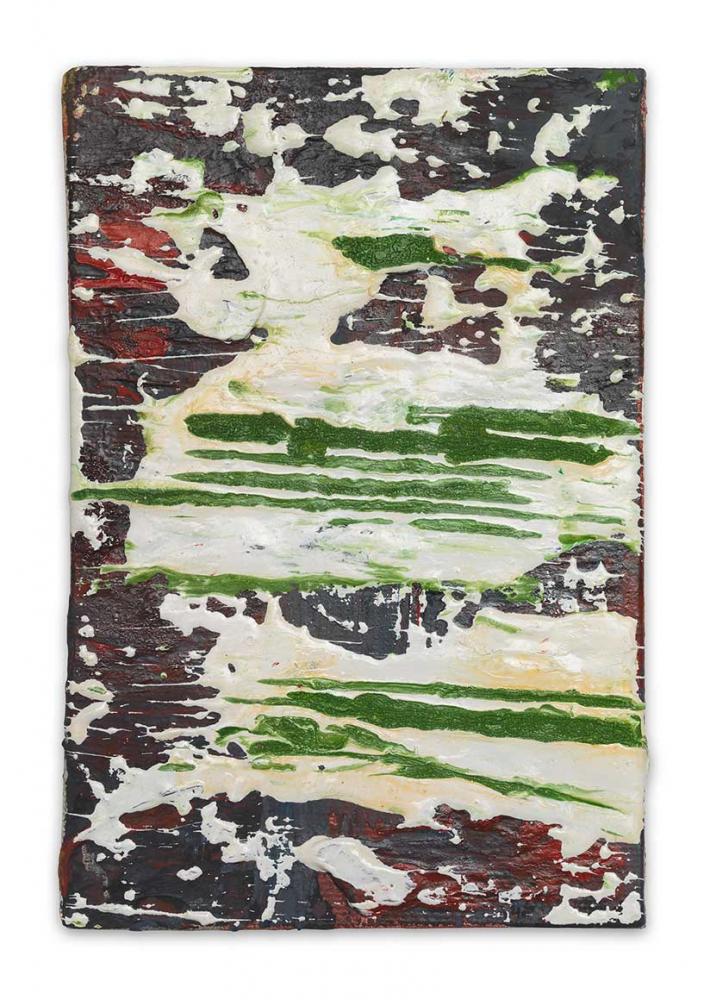
David Benforado (*1977, Athen, Griechenland), Abstrakte Stücke aus der Serie Zwischen Klang und Stille, 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe In der Serie Zwischen Klang und Stille verwendet David Benforado den Moment der Ruhe und Pause als Ausgangspunkt, um einen neuen Raum der Kontemplation zu schaffen.
Musik Malen
„So wie sich eine ganze Welt in fünf Tönen auftut, so eröffnet sich eine ganze Welt in fünf Farben.“
Mit diesen Worten beschreibt David Benforado, Maler und Musiker zugleich, sein Verständnis von Kunst. Makams Malen und Zwischen Klang und Stille lauten dementsprechend auch die Titel der beiden Serien, die ab 2016 im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin zu erwerben waren. Musik und Malerei verbinden sich in den kleinformatigen Ölbildern zu abstrakten Farbstudien voller Kraft und Energie.
Seit er malt, arbeitet David Benforado mit Musik. Immer wieder fanden in seinem Atelier Sessions mit professionellen Musikern statt, so zum Beispiel während seiner Zeit in Budapest mit dem Akkordeonisten David Yengiburgan oder später in Berlin mit dem Pianisten Antonis Anissegos. 2009 begann Benforado mit dem Studium der orientalischen Nay-Flöte und entdeckte für sich die Welt der Makams und modalen Musik des östlichen Mittelmeerraums. Sie ist eine Quelle der Inspiration für seine Malerei geworden.
Das Licht auf Syros
David Benforado wuchs in Griechenland auf. Das besondere Licht dieser Region ist, wie er sagt, „ein Teil von mir“
. Besonders prägend für den Künstler war ein zweijähriger Aufenthalt auf der griechischen Insel Syros im Mittelmeer. Im Rhythmus der Tage und Jahreszeiten beobachtete und analysierte er das Licht in all seinen Schattierungen und Wandlungen und entwickelte eine veränderte Wahrnehmung der Farben sowie neue Wege ihrer Verwendung.
Bei den je 200 Ölbildern der beiden Serien für den Kunstautomaten, jedes für sich ein Unikat, verwendete der Künstler beim Malen zwei unterschiedliche Techniken. Seine Farben mischte er, wie immer, aus Pigmenten selbst: In der ersten Variante legte er mehrere Farbschichten nach und nach übereinander. Zwischenzeitlich trockneten die Farben, die letzte Schichtung erfolgte nach der Methode „nass auf nass“. In der zweiten Variante erfolgte der Farbauftrag in einem Schwung, verbunden mit dem Hören von modaler Musik. Die dieser Musik zugrundeliegenden Makams – Tonfolgen, die jeweils durch bestimmte Intervalle und einen charakteristischen Melodieverlauf gekennzeichnet sind – stehen jeweils für unterschiedliche Affekte. Jedes Bild überträgt das Timbre und die Klangfarbe eines spezifischen Makams. Diese Werke sind Studien für größere Gemälde.
Die Bilder Benforados rufen Assoziationen an die Natur hervor: Wogen, Wellen, Feuer, Wind, das Rauschen von Blättern, Sonnenlicht und Himmel. Jedes von ganz eigenem Charakter, laden sie zu meditativer Versenkung ein und dazu, zu entdecken, was sich hinter ihrer Oberfläche befindet.
Leonore Maier, Sammlungen
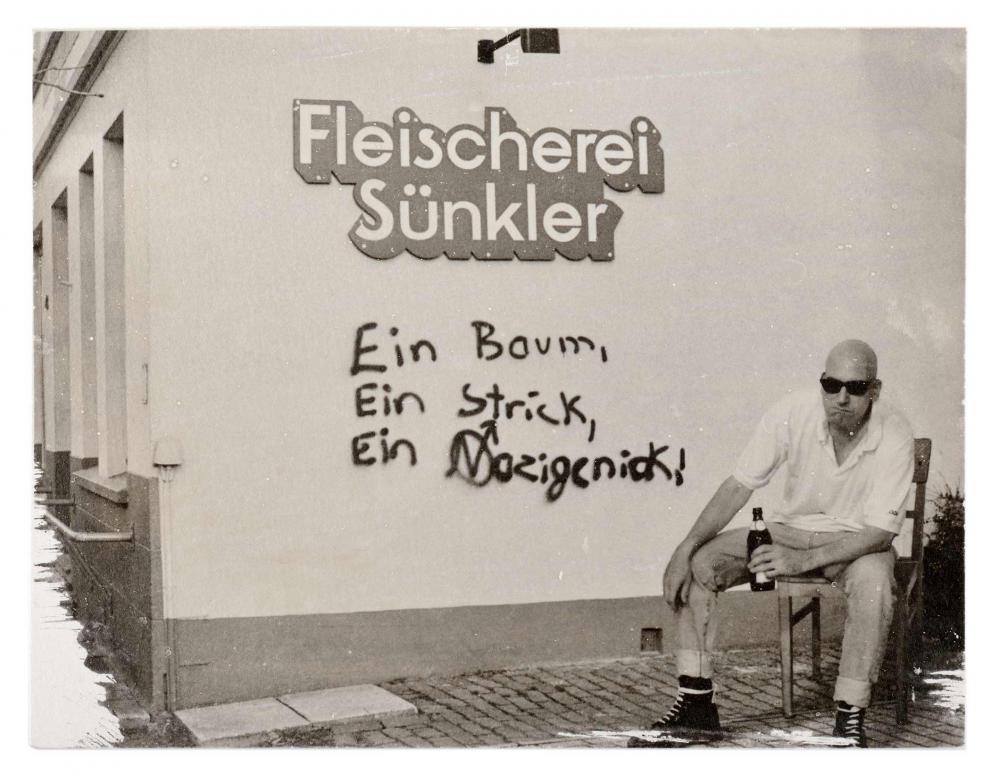
Joachim Seinfeld (*1962, Paris, Frankreich), HeimatReisen – Oldenburg; Jüdisches Museum Berlin.
„Kunst muss unter die Leute
“ - Die HeimatReisen von Joachim Seinfeld
Das Wunderbare an Berlin ist für mich als Historikerin, dass an jeder Ecke neue Orte warten, die mich beeindrucken und mein „historisches Herz“ höher schlagen lassen. Im Jahr 2016 lernte ich wieder einen dieser Orte kennen, als ich Joachim Seinfeld für ein Interview in seinem Atelier im alten Funkhaus im Bezirk Treptow-Köpenick besuchte, um mit ihm über HeimatReisen, sein Projekt für den Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin, zu sprechen.
Das Funkhaus in der Nalepastraße ist ein besonderer Ort: Ab 1956 produzierten und sendeten von dort aus alle überregionalen Sender der ehemaligen DDR. Nach 1991 nahmen in diesem Gebäude die neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Arbeit auf und nach vielen Besitzerwechseln steht das Gebäude nun Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt offen, die in den ehemaligen Büros ihre Ateliers eingerichtet haben.
Michaela Roßberg: Lieber Joachim, deine Fotoserie, die Besucherinnen und Besucher im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin erwerben konnten, besteht aus mehreren Bildern, die dich selbst an verschiedenen Orten in Deutschland zeigen. Warum hast Du aus allen Deinen Arbeiten gerade diese Aufnahmen für den Kunstautomaten gewählt?
Joachim Seinfeld: Es gab bereits 2006 eine Fotoserie, die sich auf Polen bezog. 2011 hatte ich die Idee, eine ähnliche Reihe auch für Deutschland machen. Ich wollte diese Serie also sowieso machen und habe die für mich interessantesten Bilder ausgewählt.
Michaela Roßberg: Dann sind die Orte, an denen Du auf Deinen Bildern zu sehen bist, auch gleichzeitig Stationen aus Deinem Leben?
Joachim Seinfeld: Polen, Deutschland und Italien sind Länder, in denen ich länger war und mit denen mich Wichtiges verbindet. Ich wollte aus der Serie zu diesen Ländern immer eine Trilogie machen. Die Bilder sind meist an Orten entstanden, an denen ich mich länger aufgehalten habe oder in der Nähe dieser Orte. Ich komme aus München, habe in Italien, dann in Oldenburg gewohnt, habe zwei Jahre in Polen gearbeitet und lebe nun schon lange in Berlin. Die veränderten bzw. ergänzten Bilder der Orte in HeimatReisen spielen mit den Vorstellungen, den Klischees eines vermeintlich typischen Deutschlands.
Michaela Roßberg: Also ist mit dem Titel HeimatReisen nicht gemeint, dass Du diese Orte als deine Heimat bezeichnest?
Joachim Seinfeld: Nein, wenn ich über den Begriff Heimat nachdenke, kann ich mich am ehesten in dem Wort Jurt wiederfinden. Es ist das türkische Wort für Heimat und die Jurte, das Zelt, welches Nomaden als Behausung mit sich führen, ist daraus abgeleitet. Es ist Heimat, die man mit auf Reisen nehmen kann. Eben HeimatReisen. Der einzige Ort, an dem ich so etwas wie „Heimatgefühle“ bekomme, ist in den Bergen, der Landschaft meiner Kindheit. Heimat ist für mich mehr ein Gefühl als ein bestimmter Ort. Es hängt eher mit den Stationen meines Lebens zusammen. Und ist mit Sicherheit nicht an ein Nationalgefühl gebunden.
Michaela Roßberg: Wäre dein Verständnis des Begriffs Heimat für Dich ein anderer, wenn Du nicht in Deutschland leben würdest?
Joachim Seinfeld: Gut möglich. Das Problem ist, dass der deutsche Begriff durch die deutsche Geschichte und die Besetzung des Wortes völlig diskreditiert ist. Dabei ist Heimat durchaus ein schöner Begriff, denn er hat etwas mit „zu Hause“ zu tun, mit dem Heim. Ich finde das wesentlich angenehmer als beispielsweise „patria“, was auf Italienisch Vaterland bedeutet. Da habe ich irgendwie gleich den Gedanken an Stechschritt im Hinterkopf.
Michaela Roßberg: Andere Länder haben oft eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Begriff Heimat. Ist es also eher ein „deutsches Problem“?
Joachim Seinfeld: In gewisser Weise ja, aber ich persönlich habe auch bei anderen Ländern ein Problem damit. Vor allem, wenn der Begriff Heimat in die Nähe von Patriotismus gerückt wird. Meiner Meinung nach ist das Wort Patriotismus immer ganz eng mit dem Gedanken verbunden, dass man das eigene Land besser findet als andere, dass man glaubt besser zu sein als andere. Ich denke, dass man sich heutzutage, wo das Reisen leichter geworden ist und man viel mehr Eindrücke in sich aufnimmt, nicht mehr in dieser Form auf die Heimat beziehen muss. Ich glaube, man kann seine Identität auch woanders herbekommen.
Michaela Roßberg: Was möchtest Du mit den Werken sagen? Ich habe mich als Betrachterin gefragt: Was willst Du mir beispielsweise mit dem Werk Oldenburg sagen? Etwa, dass es in der Stadt viele Nazis gibt?
Joachim Seinfeld: Die Arbeiten beinhalten viele Facetten und Diskussionen, die ich durchaus mit Ironie aufgreife. HeimatReisen bedeutet auch, dass die Bilder Dinge enthalten können, die ich wie ein Reisender, ein Beobachtender aufgenommen haben könnte. Natürlich ist die Inszenierung bei Oldenburg ein totales Baden in Klischees, das mache ich ja generell gerne. Aber es gibt immer einen Bezug, sei es zur Geschichte oder zu aktuellen Entwicklungen. Zum Beispiel war Oldenburg neben Weimar eine der Städte, die bereits vor 1933 eine NDSDAP-Verwaltung hatten und das Oldenburger Land war in den 1990ern ein Tummelplatz für Kameradschaften.
Michaela Roßberg: Aber was soll sich ein Betrachter bei der Ansicht Deiner Bilder denken? Hast Du etwas Bestimmtes im Sinn?
Joachim Seinfeld: So funktioniert Kunst nicht. Man macht Kunst nicht, weil die Leute etwas Bestimmtes sehen sollen. Das ist dann didaktisch-pädagogische Arbeit oder Agitprop. Man macht einfach Kunst, drückt seine Gedanken, Ideen in der gewählten Form aus, und wenn die Leute etwas darin gesehen haben, am besten das, was man intendierte, hat man Glück gehabt. Als Künstler muss man das Risiko eingehen, dass Betrachter etwas in die Kunst hinein interpretieren, das komplett an der eigenen Idee vorbeigeht.
Michaela Roßberg: Ich weiß schon, warum ich keine Künstlerin bin, das wäre mir zu unsicher.
Joachim Seinfeld: Man arbeitet ja nicht völlig ins Blaue hinein, sondern bekommt auf verschiedene Arten Feedback. Wenn Du zwanzig Jahre Kunst gemacht hast und niemand was von dir anschauen will, ist das ja auch eine Art Reaktion.
Michaela Roßberg: Warum bist es immer Du selbst, der in die Bilder hineingearbeitet ist?
Joachim Seinfeld: Erstens macht es mir unglaublich Spaß, Theater zu spielen. Und zweitens bin ich der Meinung, dass alle Aspekte einer Gesellschaft eine Person prägen, warum sollte ich also andere Personen für die Inszenierung nutzen? Es geht ja im Fall von HeimatReisen um exemplarische Bilder und da ist es relativ egal, wer zu sehen ist. Natürlich bringe ich auch individuelle Aspekte mit rein, wie beispielsweise den „Superjuden“ in Friedrichhain. Wobei der „Superjude“ in dem Fall eine Ampel umgetreten hat, was ja eigentlich eine komplett unsinnige Aktion war. Trotzdem ist er sehr zufrieden. Manchmal nimmt man sich halt zu wichtig. (lacht)
Michaela Roßberg: Ist es für Dich als Künstler befriedigend, wenn Deine Kunst per Automaten in einem Museum für sechs Euro verkauft wird?
Joachim Seinfeld: Ja, ich finde die Idee vom Kunstautomaten grandios. Kunst muss unter die Leute. Sie ist nicht nur für Reiche, sondern sollte allen Menschen zugänglich sein, auch außerhalb von Museen.
Michaela Roßberg, Wechselausstellungen

Joachim Seinfeld (*1962, Paris, Frankreich), HeimatReisen – Berlin-Schlossplatz; Jüdisches Museum Berlin.
„Kunst muss unter die Leute
“ - Die HeimatReisen von Joachim Seinfeld
Das Wunderbare an Berlin ist für mich als Historikerin, dass an jeder Ecke neue Orte warten, die mich beeindrucken und mein „historisches Herz“ höher schlagen lassen. Im Jahr 2016 lernte ich wieder einen dieser Orte kennen, als ich Joachim Seinfeld für ein Interview in seinem Atelier im alten Funkhaus im Bezirk Treptow-Köpenick besuchte, um mit ihm über HeimatReisen, sein Projekt für den Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin, zu sprechen.
Das Funkhaus in der Nalepastraße ist ein besonderer Ort: Ab 1956 produzierten und sendeten von dort aus alle überregionalen Sender der ehemaligen DDR. Nach 1991 nahmen in diesem Gebäude die neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Arbeit auf und nach vielen Besitzerwechseln steht das Gebäude nun Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt offen, die in den ehemaligen Büros ihre Ateliers eingerichtet haben.
Michaela Roßberg: Lieber Joachim, deine Fotoserie, die Besucherinnen und Besucher im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin erwerben konnten, besteht aus mehreren Bildern, die dich selbst an verschiedenen Orten in Deutschland zeigen. Warum hast Du aus allen Deinen Arbeiten gerade diese Aufnahmen für den Kunstautomaten gewählt?
Joachim Seinfeld: Es gab bereits 2006 eine Fotoserie, die sich auf Polen bezog. 2011 hatte ich die Idee, eine ähnliche Reihe auch für Deutschland machen. Ich wollte diese Serie also sowieso machen und habe die für mich interessantesten Bilder ausgewählt.
Michaela Roßberg: Dann sind die Orte, an denen Du auf Deinen Bildern zu sehen bist, auch gleichzeitig Stationen aus Deinem Leben?
Joachim Seinfeld: Polen, Deutschland und Italien sind Länder, in denen ich länger war und mit denen mich Wichtiges verbindet. Ich wollte aus der Serie zu diesen Ländern immer eine Trilogie machen. Die Bilder sind meist an Orten entstanden, an denen ich mich länger aufgehalten habe oder in der Nähe dieser Orte. Ich komme aus München, habe in Italien, dann in Oldenburg gewohnt, habe zwei Jahre in Polen gearbeitet und lebe nun schon lange in Berlin. Die veränderten bzw. ergänzten Bilder der Orte in HeimatReisen spielen mit den Vorstellungen, den Klischees eines vermeintlich typischen Deutschlands.
Michaela Roßberg: Also ist mit dem Titel HeimatReisen nicht gemeint, dass Du diese Orte als deine Heimat bezeichnest?
Joachim Seinfeld: Nein, wenn ich über den Begriff Heimat nachdenke, kann ich mich am ehesten in dem Wort Jurt wiederfinden. Es ist das türkische Wort für Heimat und die Jurte, das Zelt, welches Nomaden als Behausung mit sich führen, ist daraus abgeleitet. Es ist Heimat, die man mit auf Reisen nehmen kann. Eben HeimatReisen. Der einzige Ort, an dem ich so etwas wie „Heimatgefühle“ bekomme, ist in den Bergen, der Landschaft meiner Kindheit. Heimat ist für mich mehr ein Gefühl als ein bestimmter Ort. Es hängt eher mit den Stationen meines Lebens zusammen. Und ist mit Sicherheit nicht an ein Nationalgefühl gebunden.
Michaela Roßberg: Wäre dein Verständnis des Begriffs Heimat für Dich ein anderer, wenn Du nicht in Deutschland leben würdest?
Joachim Seinfeld: Gut möglich. Das Problem ist, dass der deutsche Begriff durch die deutsche Geschichte und die Besetzung des Wortes völlig diskreditiert ist. Dabei ist Heimat durchaus ein schöner Begriff, denn er hat etwas mit „zu Hause“ zu tun, mit dem Heim. Ich finde das wesentlich angenehmer als beispielsweise „patria“, was auf Italienisch Vaterland bedeutet. Da habe ich irgendwie gleich den Gedanken an Stechschritt im Hinterkopf.
Michaela Roßberg: Andere Länder haben oft eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Begriff Heimat. Ist es also eher ein „deutsches Problem“?
Joachim Seinfeld: In gewisser Weise ja, aber ich persönlich habe auch bei anderen Ländern ein Problem damit. Vor allem, wenn der Begriff Heimat in die Nähe von Patriotismus gerückt wird. Meiner Meinung nach ist das Wort Patriotismus immer ganz eng mit dem Gedanken verbunden, dass man das eigene Land besser findet als andere, dass man glaubt besser zu sein als andere. Ich denke, dass man sich heutzutage, wo das Reisen leichter geworden ist und man viel mehr Eindrücke in sich aufnimmt, nicht mehr in dieser Form auf die Heimat beziehen muss. Ich glaube, man kann seine Identität auch woanders herbekommen.
Michaela Roßberg: Was möchtest Du mit den Werken sagen? Ich habe mich als Betrachterin gefragt: Was willst Du mir beispielsweise mit dem Werk Oldenburg sagen? Etwa, dass es in der Stadt viele Nazis gibt?
Joachim Seinfeld: Die Arbeiten beinhalten viele Facetten und Diskussionen, die ich durchaus mit Ironie aufgreife. HeimatReisen bedeutet auch, dass die Bilder Dinge enthalten können, die ich wie ein Reisender, ein Beobachtender aufgenommen haben könnte. Natürlich ist die Inszenierung bei Oldenburg ein totales Baden in Klischees, das mache ich ja generell gerne. Aber es gibt immer einen Bezug, sei es zur Geschichte oder zu aktuellen Entwicklungen. Zum Beispiel war Oldenburg neben Weimar eine der Städte, die bereits vor 1933 eine NDSDAP-Verwaltung hatten und das Oldenburger Land war in den 1990ern ein Tummelplatz für Kameradschaften.
Michaela Roßberg: Aber was soll sich ein Betrachter bei der Ansicht Deiner Bilder denken? Hast Du etwas Bestimmtes im Sinn?
Joachim Seinfeld: So funktioniert Kunst nicht. Man macht Kunst nicht, weil die Leute etwas Bestimmtes sehen sollen. Das ist dann didaktisch-pädagogische Arbeit oder Agitprop. Man macht einfach Kunst, drückt seine Gedanken, Ideen in der gewählten Form aus, und wenn die Leute etwas darin gesehen haben, am besten das, was man intendierte, hat man Glück gehabt. Als Künstler muss man das Risiko eingehen, dass Betrachter etwas in die Kunst hinein interpretieren, das komplett an der eigenen Idee vorbeigeht.
Michaela Roßberg: Ich weiß schon, warum ich keine Künstlerin bin, das wäre mir zu unsicher.
Joachim Seinfeld: Man arbeitet ja nicht völlig ins Blaue hinein, sondern bekommt auf verschiedene Arten Feedback. Wenn Du zwanzig Jahre Kunst gemacht hast und niemand was von dir anschauen will, ist das ja auch eine Art Reaktion.
Michaela Roßberg: Warum bist es immer Du selbst, der in die Bilder hineingearbeitet ist?
Joachim Seinfeld: Erstens macht es mir unglaublich Spaß, Theater zu spielen. Und zweitens bin ich der Meinung, dass alle Aspekte einer Gesellschaft eine Person prägen, warum sollte ich also andere Personen für die Inszenierung nutzen? Es geht ja im Fall von HeimatReisen um exemplarische Bilder und da ist es relativ egal, wer zu sehen ist. Natürlich bringe ich auch individuelle Aspekte mit rein, wie beispielsweise den „Superjuden“ in Friedrichhain. Wobei der „Superjude“ in dem Fall eine Ampel umgetreten hat, was ja eigentlich eine komplett unsinnige Aktion war. Trotzdem ist er sehr zufrieden. Manchmal nimmt man sich halt zu wichtig. (lacht)
Michaela Roßberg: Ist es für Dich als Künstler befriedigend, wenn Deine Kunst per Automaten in einem Museum für sechs Euro verkauft wird?
Joachim Seinfeld: Ja, ich finde die Idee vom Kunstautomaten grandios. Kunst muss unter die Leute. Sie ist nicht nur für Reiche, sondern sollte allen Menschen zugänglich sein, auch außerhalb von Museen.
Michaela Roßberg, Wechselausstellungen

Noga Shtainer (*1982, Safed, Israel), #1 aus der Serie Twins: duo morality, Edition, 2015; Jüdisches Museum Berlin.
Im Schatten des Mengele-Mythos
Noga Shtainer war mit ihrer Kamera schon häufig auf Reisen, zum Beispiel für ihre Fotoprojekte Home for Special Children in der Ukraine oder Twins in Brasilien. Aufnahmen aus diesem Projekt waren 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung zu erwerben. Seit 2010 lebt die Fotografin in Berlin, wo ich sie 2014 auch kennengelernt habe.
Bewerbungs-Coup
Dass Noga Shtainer Fotografin ist, ist Zufall, denn eigentlich wollte sie Schauspielerin werden. Doch die Aufnahmeprüfung an der WIZO Kunstschule in Haifa bestand sie nicht. Stattdessen wurde ihr empfohlen, sie solle sich für die Fotoklasse bewerben. Zur Einreichung der Bewerbungsmappe blieben Noga allerdings nur zwei Tage Zeit. Daher reichte sie in einem einfachen Umschlag Fotografien ein und gab vor, es seien Aufnahmen, die sie von ihrer Halbschwester gemacht habe. Tatsächlich waren es Aufnahmen aus dem Familienalbum, die Noga Shtainer selbst in jungen Jahren zeigen. Der Coup gelang und Noga Shtainer wurde mit gerade einmal 15 Jahren an der Kunstschule akzeptiert. So begann ihre Laufbahn als Fotografin.
Das Ungleiche im Gleichen
Die Porträtfotografien von Noga Shtainer zeichnen sich durch Hingabe und Intensität aus. Das sieht man auch in der Reihe Twins – Duo Morality: Die Ähnlichkeit zwischen zwei genetisch identischen Menschen und das gleichzeitige Verlangen der Außenstehenden, sie unterscheiden zu wollen, machte die Fotografin neugierig. Und so begann Noga Shtainer schon in Israel, das Ungleiche im Gleichen fotografisch festzuhalten. 2010 folgte sie dann einer merkwürdigen Spur in der dunklen Geschichte des Rassenwahns nationalsozialistischer Ideologien: In Cândido Gódoi im Süden Brasiliens soll die ungewöhnlich hohe Dichte an Zwillingsgeburten mit den Versuchen von Josef Mengele in Verbindung stehen. Die Kleinstadt besteht überwiegend aus deutschen und polnischen Auswanderern und ihren Nachfahren, die sich während des Ersten Weltkrieges im Süden Brasiliens ansiedelten. In der Nähe soll Josef Mengele in den 1960er-Jahren gelebt und unbehelligt unter anderem Namen als Arzt praktiziert haben. Er hatte an jüdischen Gefangenen in Auschwitz brutale medizinische Versuche durchgeführt, darunter zahlreiche barbarische Experimente an Zwillingen. Die Ergebnisse soll er dann für diverse Behandlungen von Patienten in Brasilien genutzt haben. Angeblich in Folge wurden dort ungewöhnlich viele eineiige Zwillinge geboren. Diese Geschichte ist weder historisch zu belegen noch sprechen genügend Evidenzen für genmanipulierte Schwangerschaften in dieser Stadt. Lediglich die vielen blonden und blauäugigen Zwillingspaare lassen den Mengele-Mythos weiterleben und beflügeln noch immer die Fantasie von Autoren, Filmemachern und Journalisten.
Der Mythos wird zweitrangig
Als Noga Shtainer in Cândido Gódoi ankam, musste sie zunächst nach ihren Fotomodellen suchen, denn Zwillinge treten natürlich nicht immer im Doppelpack auf. Eine Zeit intensiver Recherche, der Gang von Tür zu Tür und eifrige Nachbarschaftsanfragen folgten, bis Noga 50 Zwillingspaare fand, die auch bereit waren, sich fotografieren zu lassen.
Noga Shtainers Intention, der Spur dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, wurde zweitrangig gegenüber der Aussage der Porträtfotografien, denn im Vordergrund steht etwas anderes: Wir sehen Zwillinge in ihrem Wohnumfeld, im Garten oder auf der Veranda, die fast identisch aussehen und sich erst bei einem genauen Vergleich unterscheiden. Als Betrachterin der Fotografien ertappe ich mich, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich ein Merkmal zur Unterscheidung gefunden habe. Mal sind es die Haare, dann die Figur oder doch der leichte Unterschied der Nasen, der Augen oder eines Muttermals. Man trainiert, genauer hinzuschauen und die Details zu erkennen, die Umgebung und die Position beider Personen im Bild zu vergleichen und vielleicht auch deren Beziehung zueinander zu hinterfragen. Bei näherer Betrachtung werden die Porträtierten vertrauter, die augenscheinliche Übereinstimmung verschwindet vor der Erkenntnis, dass jeder Zwilling individuell ist.
Zwei mal zwei
Für den Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin hat sich Noga Shtainer auf ein Experiment eingelassen und zeigt ihre Arbeiten in einem ungewöhnlichen Format. Normalerweise präsentiert sie ihre Arbeiten in wandfüllender Größe, was für den doch recht kompakten Automaten und seine Kunstschätze nicht machbar gewesen wäre. Aber sie ließ sich auf die Herausforderung ein und zeigt ihre Arbeiten entsprechend kleiner, dafür in vierfacher Ausführung – quasi passend zum Motto – als Zwillingsserie. Wenn man zum Beispiel das Zwillingspaar Nelson und Noberto beobachtet, wie sie mit ihren wilhelminischen Schnurrbärten am Gartenzaun die richtige Position für ein gelungenes Foto suchen, wirken die handsignierten Exemplare wie kleine Bildergeschichten.
Übrigens fotografierte Noga Shtainer nach ihrem geglückten Coup zur Aufnahme an der Akademie tatsächlich ihre Halbschwester. Zwölf Jahre lang machte sie an jedem Schabbat eine Aufnahme von Ella für die Serie Near Conscious. Es entstanden intensive Bilder eines heranwachsenden jungen Mädchens. Inzwischen wird Noga Shtainer von einer der bekanntesten Galerien in Israel vertreten und auch in Berlin stellte sie bis Mitte Februar 2016 ihre Fotoserien Wagenburg und Near Conscious aus.
Jihan Radjai, Ausstellung und Sammlungen

Noga Shtainer (*1982, Safed, Israel), #2 aus der Serie Twins: duo morality, Edition, 2015; Jüdisches Museum Berlin.
Im Schatten des Mengele-Mythos
Noga Shtainer war mit ihrer Kamera schon häufig auf Reisen, zum Beispiel für ihre Fotoprojekte Home for Special Children in der Ukraine oder Twins in Brasilien. Aufnahmen aus diesem Projekt waren 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung zu erwerben. Seit 2010 lebt die Fotografin in Berlin, wo ich sie 2014 auch kennengelernt habe.
Bewerbungs-Coup
Dass Noga Shtainer Fotografin ist, ist Zufall, denn eigentlich wollte sie Schauspielerin werden. Doch die Aufnahmeprüfung an der WIZO Kunstschule in Haifa bestand sie nicht. Stattdessen wurde ihr empfohlen, sie solle sich für die Fotoklasse bewerben. Zur Einreichung der Bewerbungsmappe blieben Noga allerdings nur zwei Tage Zeit. Daher reichte sie in einem einfachen Umschlag Fotografien ein und gab vor, es seien Aufnahmen, die sie von ihrer Halbschwester gemacht habe. Tatsächlich waren es Aufnahmen aus dem Familienalbum, die Noga Shtainer selbst in jungen Jahren zeigen. Der Coup gelang und Noga Shtainer wurde mit gerade einmal 15 Jahren an der Kunstschule akzeptiert. So begann ihre Laufbahn als Fotografin.
Das Ungleiche im Gleichen
Die Porträtfotografien von Noga Shtainer zeichnen sich durch Hingabe und Intensität aus. Das sieht man auch in der Reihe Twins – Duo Morality: Die Ähnlichkeit zwischen zwei genetisch identischen Menschen und das gleichzeitige Verlangen der Außenstehenden, sie unterscheiden zu wollen, machte die Fotografin neugierig. Und so begann Noga Shtainer schon in Israel, das Ungleiche im Gleichen fotografisch festzuhalten. 2010 folgte sie dann einer merkwürdigen Spur in der dunklen Geschichte des Rassenwahns nationalsozialistischer Ideologien: In Cândido Gódoi im Süden Brasiliens soll die ungewöhnlich hohe Dichte an Zwillingsgeburten mit den Versuchen von Josef Mengele in Verbindung stehen. Die Kleinstadt besteht überwiegend aus deutschen und polnischen Auswanderern und ihren Nachfahren, die sich während des Ersten Weltkrieges im Süden Brasiliens ansiedelten. In der Nähe soll Josef Mengele in den 1960er-Jahren gelebt und unbehelligt unter anderem Namen als Arzt praktiziert haben. Er hatte an jüdischen Gefangenen in Auschwitz brutale medizinische Versuche durchgeführt, darunter zahlreiche barbarische Experimente an Zwillingen. Die Ergebnisse soll er dann für diverse Behandlungen von Patienten in Brasilien genutzt haben. Angeblich in Folge wurden dort ungewöhnlich viele eineiige Zwillinge geboren. Diese Geschichte ist weder historisch zu belegen noch sprechen genügend Evidenzen für genmanipulierte Schwangerschaften in dieser Stadt. Lediglich die vielen blonden und blauäugigen Zwillingspaare lassen den Mengele-Mythos weiterleben und beflügeln noch immer die Fantasie von Autoren, Filmemachern und Journalisten.
Der Mythos wird zweitrangig
Als Noga Shtainer in Cândido Gódoi ankam, musste sie zunächst nach ihren Fotomodellen suchen, denn Zwillinge treten natürlich nicht immer im Doppelpack auf. Eine Zeit intensiver Recherche, der Gang von Tür zu Tür und eifrige Nachbarschaftsanfragen folgten, bis Noga 50 Zwillingspaare fand, die auch bereit waren, sich fotografieren zu lassen.
Noga Shtainers Intention, der Spur dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, wurde zweitrangig gegenüber der Aussage der Porträtfotografien, denn im Vordergrund steht etwas anderes: Wir sehen Zwillinge in ihrem Wohnumfeld, im Garten oder auf der Veranda, die fast identisch aussehen und sich erst bei einem genauen Vergleich unterscheiden. Als Betrachterin der Fotografien ertappe ich mich, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich ein Merkmal zur Unterscheidung gefunden habe. Mal sind es die Haare, dann die Figur oder doch der leichte Unterschied der Nasen, der Augen oder eines Muttermals. Man trainiert, genauer hinzuschauen und die Details zu erkennen, die Umgebung und die Position beider Personen im Bild zu vergleichen und vielleicht auch deren Beziehung zueinander zu hinterfragen. Bei näherer Betrachtung werden die Porträtierten vertrauter, die augenscheinliche Übereinstimmung verschwindet vor der Erkenntnis, dass jeder Zwilling individuell ist.
Zwei mal zwei
Für den Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin hat sich Noga Shtainer auf ein Experiment eingelassen und zeigt ihre Arbeiten in einem ungewöhnlichen Format. Normalerweise präsentiert sie ihre Arbeiten in wandfüllender Größe, was für den doch recht kompakten Automaten und seine Kunstschätze nicht machbar gewesen wäre. Aber sie ließ sich auf die Herausforderung ein und zeigt ihre Arbeiten entsprechend kleiner, dafür in vierfacher Ausführung – quasi passend zum Motto – als Zwillingsserie. Wenn man zum Beispiel das Zwillingspaar Nelson und Noberto beobachtet, wie sie mit ihren wilhelminischen Schnurrbärten am Gartenzaun die richtige Position für ein gelungenes Foto suchen, wirken die handsignierten Exemplare wie kleine Bildergeschichten.
Übrigens fotografierte Noga Shtainer nach ihrem geglückten Coup zur Aufnahme an der Akademie tatsächlich ihre Halbschwester. Zwölf Jahre lang machte sie an jedem Schabbat eine Aufnahme von Ella für die Serie Near Conscious. Es entstanden intensive Bilder eines heranwachsenden jungen Mädchens. Inzwischen wird Noga Shtainer von einer der bekanntesten Galerien in Israel vertreten und auch in Berlin stellte sie bis Mitte Februar 2016 ihre Fotoserien Wagenburg und Near Conscious aus.
Jihan Radjai, Ausstellung und Sammlungen

Rachel Kohn (*1962, Prag, Tschechoslowakische Republik, heute: Tschechische Republik), 100 Stühle, 100 Häuser; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Keramik für alle Lebenslagen - Der Freundeskreis zu Besuch bei Rachel Kohn
Noch bevor Rachel Kohns Kunstwerke in unserem Kunstautomaten zu erwerben waren, hatten die Freunde des Jüdischen Museums Berlin das Vergnügen, die Künstlerin in ihrem Atelier in Berlin Charlottenburg kennenzulernen. Für die vierte Runde des Kunstautomaten hat Rachel Kohn Miniaturstühle und -häuser entworfen, die wir bei unserem Vorab-Besuch bewundern durften.
Beim Betreten des Atelier-Häuschens lachen uns buntes Geschirr und fantasievolle Judaica an, an den Wänden reihen sich kleine Häuser und Stühle aus Ton, und auf weißen Sockeln thronen Skulpturen. Der Duft von frischem Kaffee und Tee, der uns in handgefertigten Bechern gereicht wird, erfüllt den Raum – ein herzliches Willkommen.
Lebensweg ins Atelier
Rachel Kohn wurde in Prag geboren und emigrierte später nach München, wo die Meisterschülerin an der Akademie der Bildenden Künste München ihre Karriere als Bildhauerin und Keramikerin begann. Sie machte einen Studienaustausch mit Bezalel in Jerusalem, bereiste Bolivien und Mexiko und kam 1993 mit ihrem Mann nach Berlin. Heute stellt sie in zahlreichen Galerien deutschlandweit aus und engagiert sich im Vorstand des Frauenmuseums Berlin für die Förderung professionell arbeitender Künstlerinnen.
Unseren Atelierrundgang beginnen wir an einem schmalen Regal, auf dem sich bunte Keramik stapelt. Jedes Stück – unabhängig von seiner Größe – hält Rachel mindestens zehn Mal in den Händen, bevor es fertiggestellt ist. Kunstvoll werden Teller, Tassen, Butterdosen und „Rachels keramische Tupperware“ bemalt und verziert; jedes Stück ist ein Unikat und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Vielfalt ist so groß, dass Rachel manchmal von eigenen Kreationen überrascht wird, die sie bei Kunden nach Jahren wiedersieht. Sie lässt sich von Alltagssituationen inspirieren, was auch am Design ihrer Keramik zu erkennen ist: Manche Vasen sind mehrteilig und können sowohl für schmale, lange als auch für kurze, voluminöse Blumensträuße verwendet werden. Die Deckel der Stapeldosen fungieren gleichzeitig als Teller, und damit die Ästhetik auch im Badezimmer nicht zu kurz kommt, erhält die Toilettenbürste einen bunt verzierten Halter.
Häuser, Stühle und Familie
Nach den Alltagsgegenständen zeigt Rachel uns ihre zahlreichen Ton- und Bronzeskulpturen. Mit dem wiederkehrenden Motiv der Häuser und Stühle, die 2016 in unserem Kunstautomaten zu erwerben waren, thematisiert die Künstlerin ihre Sichtweise auf Familie und zwischenmenschliche Beziehungen. So kann man die Stühle drehen und auf unterschiedlichste Weise miteinander kommunizieren lassen: Sich gegenüberstehend mimen sie ein Gespräch und mit den Stuhlrücken zueinander einen Konflikt. Den Interpretationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, das macht Rachels Kunst so interessant.
Weitere Highlights des Atelierbesuchs sind eine große Bronze, die ein Tanzpaar darstellt, sowie ein weißes Kinderbett, das von einer bedrohlichen schwarzen Wolke überbeschattet wird. Die Skulptur ist die Vorlage für ein Mahnmal zum Gedenken an ermordete Kinder von Zwangsarbeiterinnen im Zweiten Weltkrieg. Die Skulptur wurde von der niedersächsischen Gemeinde Otterndorf in Auftrag gegeben und 2009 eingeweiht.
Weihnachts-Chanukkia
Zum Abschluss führt uns die Künstlerin ihre Judaica vor, die zum Teil auch in unserem Museumsshop zu erwerben sind. Besonders ins Auge sticht ein Chanukka-Leuchter in Form eines Tannenbaums – Weihnukka lässt grüßen! Aber auch die Pessach-Teller, Mesusot und Kiddusch-Becher lassen Rachels Ideenreichtum erkennen, da sie sich im Handumdrehen in Alltagsgegenstände umwandeln lassen. So gibt sich zum Beispiel eine Dose erst beim Öffnen des Deckels als Chanukkia zu erkennen und ein anderer Chanukka-Leuchter kann gedreht und als Shabbatleuchter verwendet werden – so muss er nach den Feiertagen nicht ein Jahr auf seinen nächsten Einsatz warten.
Lea Ledwon, Veranstaltungen
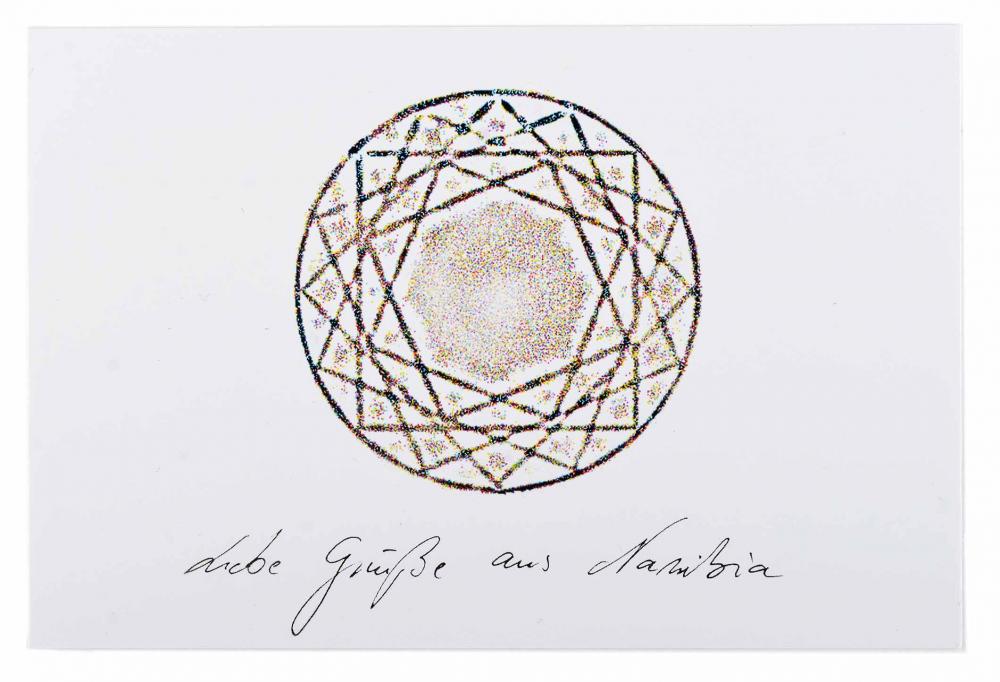
Shira Wachsmann (*1984, Tel Aviv, Israel), Liebe Grüße aus Namibia, Postkarte, 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Erinnerung per Post – an den fast vergessenen Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia
Die Straßen in Kreuzberg sind an diesem grauen Februartag nassgeregnet. Shira Wachsmann, eine zierliche junge Frau mit kurzem, schwarzem Haar, führt mich in ihr Atelier in einer Altbauwohnung. Ihre Zeit ist knapp. Denn am 13. März 2016 eröffnet Wachsmann Tribe Fire, eine Solo-Ausstellung in der Galerie cubus-m in Schöneberg, die dort noch bis zum 23. April 2016 zu sehen war. Im Atelier hängen große Zeichnungen, die später Teil der Installation werden. „Es gibt noch viel zu tun
“, erklärt die gebürtige Israelin.
Eingekreist, ausgeklammert
Auf dem Schreibtisch liegt ihr neustes Kunstprojekt, zwei Postkarten, die Wachsmann für das Jüdische Museum Berlin entworfen hat. Sie waren in einer Auflage von je 400 Stück 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Museums käuflich zu erwerben. Wachsmann nimmt in einem grünen Sessel Platz und betrachtet die Karten. Sie zeigen zwei kreisrunde Motive, eine Form, die sich wie ein Grundgedanke durch das Werk der Künstlerin zieht. Hier stellen sie einen abstrakten Diamanten und eine schwarze Sonne dar.
„Meine Beschäftigung mit dem Kreismotiv begann 2012, als ich in einem israelischen Antiquariat eine Landkarte von Palästina aus der britischen Mandatszeit fand
“, erinnert sie sich und weist auf den kopierten Plan. Jüdische Ortschaften wurden darauf in den 1950er-Jahren violett eingekreist, besiegte oder verlassene arabische Dörfer eingeklammert. Der Kreis veranschaulicht Zugehörigkeit und zugleich Abgrenzung, er symbolisiert Ewigkeit und Exklusivität. „Die zionistische Bewegung kann als eine koloniale Bewegung interpretiert werden
“, sagt Wachsmann und weiß um die provokative Wirkung dieser These. Sie selbst wuchs in einem Dorf in Galiläa an der Grenze zum Libanon auf. Eigens von den jüdischen Einwanderern gepflanzte Kiefernwälder ahmen dort eine europäische Landschaft nach. Ruinen von verlassenen arabischen Dörfern prägen Wachsmanns Kindheitserinnerungen. Seit sie in Berlin lebt, betrachtet sie ihr Heimatland mit größerem Abstand.
„Liebe Grüße aus Namibia“
Shira Wachsmann reflektiert über Kolonialismus und Vertreibung längst nicht mehr nur mit Bezug auf Israel. In ihren Werken für den Kunstautomaten im Jüdischen Museum Berlin beschäftigt sie sich mit dem Genozid an den Herero zwischen den Jahren 1904 und 1908, verantwortet durch das Deutsche Kaiserreich. Dieser markierte den Höhepunkt des kolonial-imperialistischen Weltmachtstrebens.
Auch die Zustandsform des Materials, mit dem sie sich beschäftigt, hat sich verändert. Angefangen hat sie mit Kohle, einem archaischen Element und Überrest kreisrunder Lagerfeuerversammlungen. Schließlich wandte sie sich dem Diamanten zu, einer Modifikation des Kohlenstoffs. Mit dem farblosen Kristall assoziiert sie die koloniale Ausbeutung Südwestafrikas, des heutigen Namibias. „Liebe Grüße aus Namibia“ hat Wachsmann handschriftlich jeweils unter die Motive auf die Postkarten geschrieben. Dreht man den Gruß um, kann man auf der Rückseite ein Zitat des damaligen Staatssekretärs des Äußeren und späteren Reichskanzlers, Bernhard von Bülow (1849–1929), lesen: „Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.“ An die Stelle der Briefmarke hat Wachsmann einen Totenkopf gesetzt. Das Deutsche Afrika-Korps sendete damals Grüße mit Postkarten in die ferne Heimat. Die kolonialen Machthaber gebärdeten sich darauf als Eroberer, Bilder zeigen sie mit gefangenen Herero oder mit Totenschädeln.
Was hat das mit dem Judentum zu tun?
Ganz bewusst hat Wachsmann für den Kunstautomaten im Jüdischen Museum Berlin ein Thema gewählt, das vielleicht nicht unmittelbar mit dem Judentum verknüpft wird. „Der Holocaust an den europäischen Juden überdeckt insbesondere in Israel und Deutschland alle Erinnerungen an weitere Gräueltaten, die in der Geschichte stattgefunden haben. Kenntnisse über den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, bei dem achtzig Prozent der Herero und fast die Hälfte der Nama getötet wurden, sind in der deutschen Gesellschaft so gut wie nicht vorhanden.
“ Der Völkermord an den Herero wird erst seit Sommer 2015 von der Bundesregierung offiziell als solcher bezeichnet. Die deutsche Kolonialgeschichte bleibt in deutschen Schulbüchern ein Randthema.
„Das Schöne am Kunstautomaten ist, dass man nie weiß, was man bekommt
“, sagt Wachsmann und lächelt verschmitzt. Die Geschichte der Herero wird sie bald mit ahnungslosen Besucherinnen und Besuchern teilen können. „Meine Postkarten sind auf den ersten Blick schön, sie bieten sich als Souvenir an.
“ Will man die Karten verschicken, muss man jedoch zunächst den Totenschädel mit einer deutschen Briefmarke überkleben: ein Verweis auf die Verdrängung des Genozids in Afrika aus dem kollektiven deutschen Gedächtnis.
Saro Gorgis, Ausstellungen
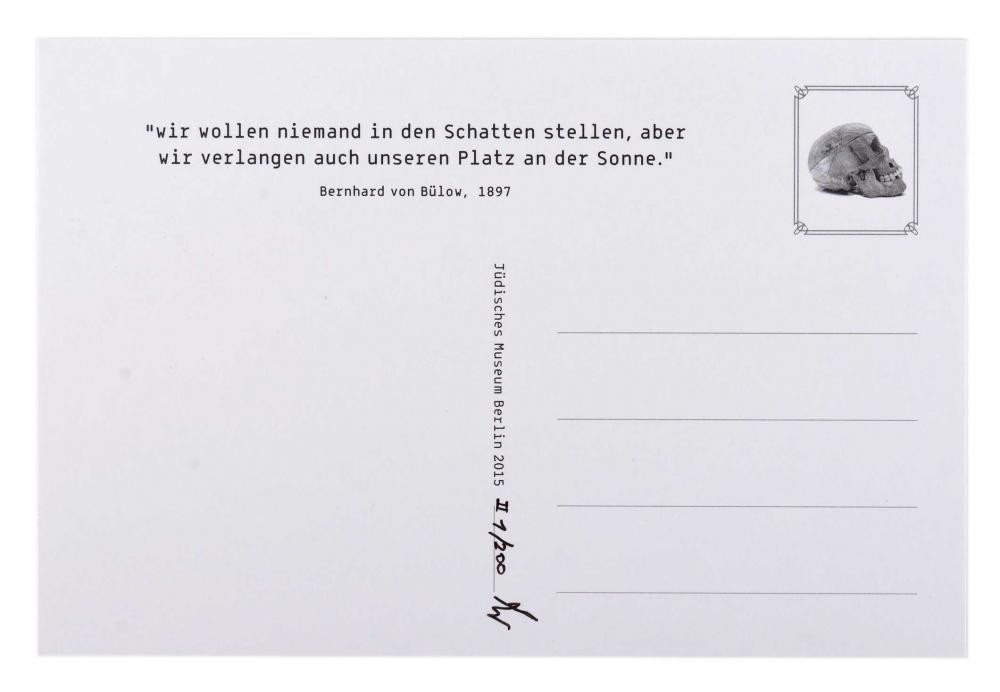
Shira Wachsmann (*1984, Tel Aviv, Israel), Liebe Grüße aus Namibia, Postkarte, 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Erinnerung per Post – der fast vergessene Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia
Die Straßen in Kreuzberg sind an diesem grauen Februartag nassgeregnet. Shira Wachsmann, eine zierliche junge Frau mit kurzem, schwarzem Haar, führt mich in ihr Atelier in einer Altbauwohnung. Ihre Zeit ist knapp. Denn am 13. März 2016 eröffnet Wachsmann Tribe Fire, eine Solo-Ausstellung in der Galerie cubus-m in Schöneberg, die dort noch bis zum 23. April 2016 zu sehen war. Im Atelier hängen große Zeichnungen, die später Teil der Installation werden. „Es gibt noch viel zu tun
“, erklärt die gebürtige Israelin.
Eingekreist, ausgeklammert
Auf dem Schreibtisch liegt ihr neustes Kunstprojekt, zwei Postkarten, die Wachsmann für das Jüdische Museum Berlin entworfen hat. Sie waren in einer Auflage von je 400 Stück 2016 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Museums käuflich zu erwerben. Wachsmann nimmt in einem grünen Sessel Platz und betrachtet die Karten. Sie zeigen zwei kreisrunde Motive, eine Form, die sich wie ein Grundgedanke durch das Werk der Künstlerin zieht. Hier stellen sie einen abstrakten Diamanten und eine schwarze Sonne dar.
„Meine Beschäftigung mit dem Kreismotiv begann 2012, als ich in einem israelischen Antiquariat eine Landkarte von Palästina aus der britischen Mandatszeit fand
“, erinnert sie sich und weist auf den kopierten Plan. Jüdische Ortschaften wurden darauf in den 1950er-Jahren violett eingekreist, besiegte oder verlassene arabische Dörfer eingeklammert. Der Kreis veranschaulicht Zugehörigkeit und zugleich Abgrenzung, er symbolisiert Ewigkeit und Exklusivität. „Die zionistische Bewegung kann als eine koloniale Bewegung interpretiert werden
“, sagt Wachsmann und weiß um die provokative Wirkung dieser These. Sie selbst wuchs in einem Dorf in Galiläa an der Grenze zum Libanon auf. Eigens von den jüdischen Einwanderern gepflanzte Kiefernwälder ahmen dort eine europäische Landschaft nach. Ruinen von verlassenen arabischen Dörfern prägen Wachsmanns Kindheitserinnerungen. Seit sie in Berlin lebt, betrachtet sie ihr Heimatland mit größerem Abstand.
„Liebe Grüße aus Namibia“
Shira Wachsmann reflektiert über Kolonialismus und Vertreibung längst nicht mehr nur mit Bezug auf Israel. In ihren Werken für den Kunstautomaten im Jüdischen Museum Berlin beschäftigt sie sich mit dem Genozid an den Herero zwischen den Jahren 1904 und 1908, verantwortet durch das Deutsche Kaiserreich. Dieser markierte den Höhepunkt des kolonial-imperialistischen Weltmachtstrebens.
Auch die Zustandsform des Materials, mit dem sie sich beschäftigt, hat sich verändert. Angefangen hat sie mit Kohle, einem archaischen Element und Überrest kreisrunder Lagerfeuerversammlungen. Schließlich wandte sie sich dem Diamanten zu, einer Modifikation des Kohlenstoffs. Mit dem farblosen Kristall assoziiert sie die koloniale Ausbeutung Südwestafrikas, des heutigen Namibias. „Liebe Grüße aus Namibia“ hat Wachsmann handschriftlich jeweils unter die Motive auf die Postkarten geschrieben. Dreht man den Gruß um, kann man auf der Rückseite ein Zitat des damaligen Staatssekretärs des Äußeren und späteren Reichskanzlers, Bernhard von Bülow (1849–1929), lesen: „Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.“ An die Stelle der Briefmarke hat Wachsmann einen Totenkopf gesetzt. Das Deutsche Afrika-Korps sendete damals Grüße mit Postkarten in die ferne Heimat. Die kolonialen Machthaber gebärdeten sich darauf als Eroberer, Bilder zeigen sie mit gefangenen Herero oder mit Totenschädeln.
Was hat das mit dem Judentum zu tun?
Ganz bewusst hat Wachsmann für den Kunstautomaten im Jüdischen Museum Berlin ein Thema gewählt, das vielleicht nicht unmittelbar mit dem Judentum verknüpft wird. „Der Holocaust an den europäischen Juden überdeckt insbesondere in Israel und Deutschland alle Erinnerungen an weitere Gräueltaten, die in der Geschichte stattgefunden haben. Kenntnisse über den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, bei dem achtzig Prozent der Herero und fast die Hälfte der Nama getötet wurden, sind in der deutschen Gesellschaft so gut wie nicht vorhanden.
“ Der Völkermord an den Herero wird erst seit Sommer 2015 von der Bundesregierung offiziell als solcher bezeichnet. Die deutsche Kolonialgeschichte bleibt in deutschen Schulbüchern ein Randthema.
„Das Schöne am Kunstautomaten ist, dass man nie weiß, was man bekommt
“, sagt Wachsmann und lächelt verschmitzt. Die Geschichte der Herero wird sie bald mit ahnungslosen Besucherinnen und Besuchern teilen können. „Meine Postkarten sind auf den ersten Blick schön, sie bieten sich als Souvenir an.
“ Will man die Karten verschicken, muss man jedoch zunächst den Totenschädel mit einer deutschen Briefmarke überkleben: ein Verweis auf die Verdrängung des Genozids in Afrika aus dem kollektiven deutschen Gedächtnis.
Saro Gorgis, Ausstellungen
April–September 2015
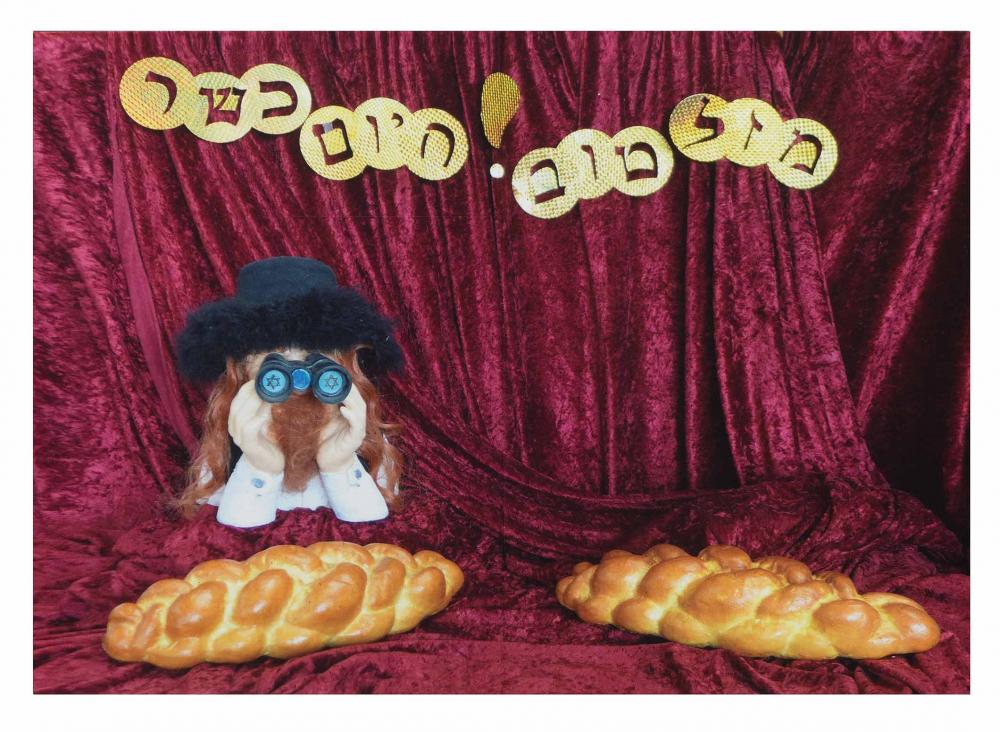
Anna Adam (*1963, Siegen, Deutschland), MAZAL TOW! Heute ist bei Ihnen alles koscher!; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
„Koscherwichtel“ und alles ist gut? Ein Gespräch mit Anna Adam
Der Weg ist nicht einfach zu finden. Wie gut, dass mich die Künstlerin an der nahegelegenen U-Bahn-Station im Wedding abholt. Gemeinsam queren wir Gewerbehöfe, kommen an einem Halal-Imbiss vorbei, steigen Treppen und stehen plötzlich vor der Ateliertür. Kaum hat Anna diese geöffnet, entdecke ich den „Koscherwichtel“, der alles mit seinem Fernglas betrachtet.
Genau diese Figur hat die Künstlerin für unseren Kunstautomaten auf eine Karte gebracht, die man durch Schneiden und Falzen in ein dreidimensionales Objekt verwandeln kann. Auf der Anleitung steht, dass man sich dieses in die Küche stellen solle und alles gut werde.
Gelia Eisert: Anna, was bedeutet der seltsame Name „Koscherwichtel“? Passen „koscher“ und „Wichtel“ überhaupt zusammen? Wieso wird dann alles gut? Ich bin irritiert.
Anna Adam: Bei uns zu Hause stand „Wichtel“ für einen kleinen, wichtigen Mann. Von diesen „wichtigen Männern“ gibt es viele. Geboren wurde mein „Koscherwichtel“ im Jahre 2002. Er soll auf jeden Fall irritieren. „Koscher“ und „Wichtel“ passen zusammen, weil ich mich der „Heilung der deutsch-jüdischen Krankheit“, wie ich das nenne, verschrieben habe. Dafür arbeite ich mit satirischen Mitteln, die im Unterschied zur Comedy tagespolitische Ausgangspunkte haben.
Gelia Eisert: Du hast sein Geburtsjahr erwähnt. Unter welchen Umständen wurde der „Koscherwichtel“ geboren?
Anna Adam: Damals hatte ich für das Jüdische Museum Franken in Fürth einen Feinkostladen erfunden. Auf die Frage, ob es „schwere Kost“ sei, die ich anbieten würde, antwortete ich „nee, das ist Feinkost“ und so entstand „Feinkost Adam“. Ich hatte für das Museum einige Kunstobjekte geschaffen, die mittels einer Art Schatzkarte in der Ausstellung aufgespürt werden konnten. Satirische Texte ergänzten die Installation. Dies hier ist ein Objekt aus der Ausstellung, mein Buch Jüdisches Atmen. Anleitung zum ausgeatmeten Glück. Die zugehörige „Brachblüte Rose von Jericho“, die das „innere Öffnen“ unterstützt, ist leider schon ausgetrunken, die war echt lecker.
Ich blättere in dem Buch, betrachte die dramaturgische Steigerung des Geschehens, die Annäherung an die „jüdische Seele“ durch „jüdisches Atmen“. Da platzt es aus mir heraus: Anna, wie absurd ist das denn!
Anna Adam: Auf Ausstellungen von der jüdischen Künstlergruppe Meshulash (hebr.: Dreieck), der ich auch angehörte, hörte ich von dauerhaft betroffenen „Philosemiten“ Kommentare wie die jüdischen Menschen sind ja so anders
. Danach entstanden spontan die Zeichnungen für das Buch.
Gelia Eisert: Obwohl alles ironisch und leicht wirkt, war die „Feinkost“ in Fürth recht schwere Kost für das Publikum, die Presse und die jüdische Gemeinde. Du wurdest sogar als Antisemitin angefeindet.
Anna Adam: Die Anzeige erwies sich als absurd und wurde abgewiesen. Satire war damals auf diesem Gebiet kaum bekannt und auch Juden projizierten alles Mögliche hinein. Die Presse überschlug sich. Da schlug die Geburtsstunde meines „Koscherwichtels“. Ich bekam nämlich den Rat: Heiraten Sie einen braven, religiösen Mann, dann kommen Sie zur Ruhe und müssen diese Sachen nicht mehr machen.
Erst atmete ich tief durch und dann antwortete ich: Schatz. Frauen wie ich müssen so einen nicht heiraten, die bauen sich einen.
Das habe ich gemacht und schau mal, hier steht er: Er ist perfekt, er ist kleiner als ich, zierlich wie Napoleon, hält die Klappe und sorgt für koscheres Tun.
Gelia Eisert: Du trennst Dich kaum von Deinem Wichtel. Wie ich gesehen habe, ist er sogar im „Happy-Hippie-Jew-Bus“ auf den Touren durch Deutschland dabei.
Anna Adam: Dabei ist vor allem meine Lebenspartnerin Jalda Rebling, Musikerin und jüdische Kantorin. Wir touren mit „BEA“, so heißt unser derzeitiger Bus, suchen Fußgängerzonen und Schulen auf, um Klischees und Vorurteile mit satirischen Mitteln aufzuweichen. Der Bus ist à la „Peace and Love mit einem deutschen Auto“ so gestaltet, dass die Leute unmöglich ernst oder betroffen bleiben können beim Thema Judentum. Im Bus sind witzige Sachen untergebracht, an denen sich viel erklären lässt. Diese Touren machen wir schon seit 2011, damals mit „BEN“, der leider durch den TÜV von uns getrennt wurde.
Gelia Eisert, Ausstellungen
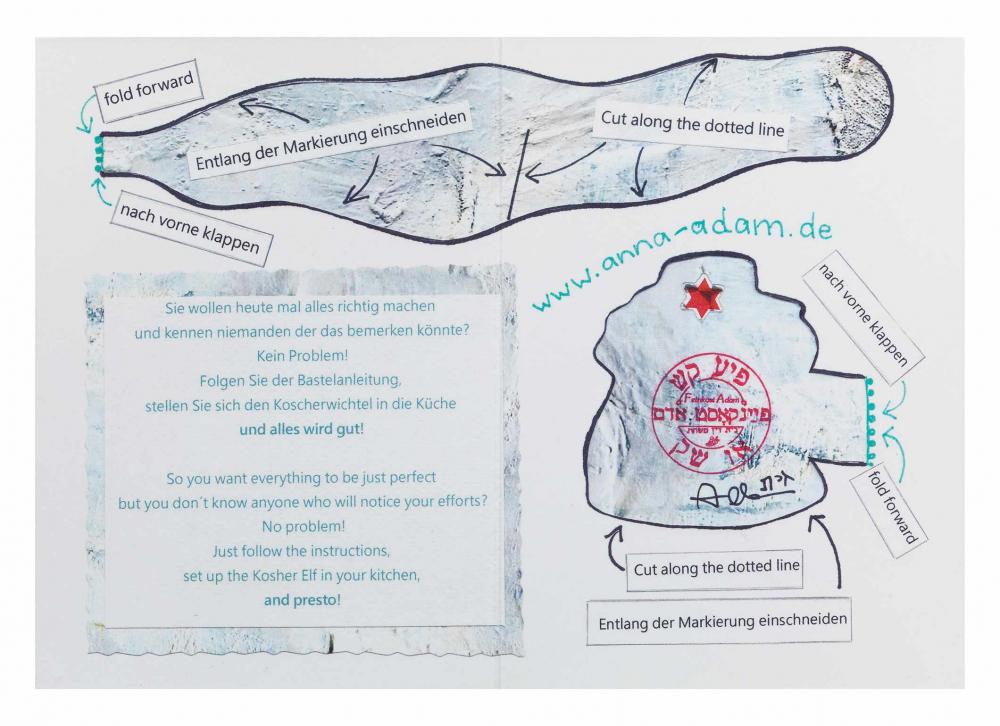
Anna Adam (*1963, Siegen, Deutschland), MAZAL TOW! Heute ist bei Ihnen alles koscher!; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
„Koscherwichtel“ und alles ist gut? Ein Gespräch mit Anna Adam
Der Weg ist nicht einfach zu finden. Wie gut, dass mich die Künstlerin an der nahegelegenen U-Bahn-Station im Wedding abholt. Gemeinsam queren wir Gewerbehöfe, kommen an einem Halal-Imbiss vorbei, steigen Treppen und stehen plötzlich vor der Ateliertür. Kaum hat Anna diese geöffnet, entdecke ich den „Koscherwichtel“, der alles mit seinem Fernglas betrachtet.
Genau diese Figur hat die Künstlerin für unseren Kunstautomaten auf eine Karte gebracht, die man durch Schneiden und Falzen in ein dreidimensionales Objekt verwandeln kann. Auf der Anleitung steht, dass man sich dieses in die Küche stellen solle und alles gut werde.
Gelia Eisert: Anna, was bedeutet der seltsame Name „Koscherwichtel“? Passen „koscher“ und „Wichtel“ überhaupt zusammen? Wieso wird dann alles gut? Ich bin irritiert.
Anna Adam: Bei uns zu Hause stand „Wichtel“ für einen kleinen, wichtigen Mann. Von diesen „wichtigen Männern“ gibt es viele. Geboren wurde mein „Koscherwichtel“ im Jahre 2002. Er soll auf jeden Fall irritieren. „Koscher“ und „Wichtel“ passen zusammen, weil ich mich der „Heilung der deutsch-jüdischen Krankheit“, wie ich das nenne, verschrieben habe. Dafür arbeite ich mit satirischen Mitteln, die im Unterschied zur Comedy tagespolitische Ausgangspunkte haben.
Gelia Eisert: Du hast sein Geburtsjahr erwähnt. Unter welchen Umständen wurde der „Koscherwichtel“ geboren?
Anna Adam: Damals hatte ich für das Jüdische Museum Franken in Fürth einen Feinkostladen erfunden. Auf die Frage, ob es „schwere Kost“ sei, die ich anbieten würde, antwortete ich „nee, das ist Feinkost“ und so entstand „Feinkost Adam“. Ich hatte für das Museum einige Kunstobjekte geschaffen, die mittels einer Art Schatzkarte in der Ausstellung aufgespürt werden konnten. Satirische Texte ergänzten die Installation. Dies hier ist ein Objekt aus der Ausstellung, mein Buch Jüdisches Atmen. Anleitung zum ausgeatmeten Glück. Die zugehörige „Brachblüte Rose von Jericho“, die das „innere Öffnen“ unterstützt, ist leider schon ausgetrunken, die war echt lecker.
Ich blättere in dem Buch, betrachte die dramaturgische Steigerung des Geschehens, die Annäherung an die „jüdische Seele“ durch „jüdisches Atmen“. Da platzt es aus mir heraus: Anna, wie absurd ist das denn!
Anna Adam: Auf Ausstellungen von der jüdischen Künstlergruppe Meshulash (hebr.: Dreieck), der ich auch angehörte, hörte ich von dauerhaft betroffenen „Philosemiten“ Kommentare wie die jüdischen Menschen sind ja so anders
. Danach entstanden spontan die Zeichnungen für das Buch.
Gelia Eisert: Obwohl alles ironisch und leicht wirkt, war die „Feinkost“ in Fürth recht schwere Kost für das Publikum, die Presse und die jüdische Gemeinde. Du wurdest sogar als Antisemitin angefeindet.
Anna Adam: Die Anzeige erwies sich als absurd und wurde abgewiesen. Satire war damals auf diesem Gebiet kaum bekannt und auch Juden projizierten alles Mögliche hinein. Die Presse überschlug sich. Da schlug die Geburtsstunde meines „Koscherwichtels“. Ich bekam nämlich den Rat: Heiraten Sie einen braven, religiösen Mann, dann kommen Sie zur Ruhe und müssen diese Sachen nicht mehr machen.
Erst atmete ich tief durch und dann antwortete ich: Schatz. Frauen wie ich müssen so einen nicht heiraten, die bauen sich einen.
Das habe ich gemacht und schau mal, hier steht er: Er ist perfekt, er ist kleiner als ich, zierlich wie Napoleon, hält die Klappe und sorgt für koscheres Tun.
Gelia Eisert: Du trennst Dich kaum von Deinem Wichtel. Wie ich gesehen habe, ist er sogar im „Happy-Hippie-Jew-Bus“ auf den Touren durch Deutschland dabei.
Anna Adam: Dabei ist vor allem meine Lebenspartnerin Jalda Rebling, Musikerin und jüdische Kantorin. Wir touren mit „BEA“, so heißt unser derzeitiger Bus, suchen Fußgängerzonen und Schulen auf, um Klischees und Vorurteile mit satirischen Mitteln aufzuweichen. Der Bus ist à la „Peace and Love mit einem deutschen Auto“ so gestaltet, dass die Leute unmöglich ernst oder betroffen bleiben können beim Thema Judentum. Im Bus sind witzige Sachen untergebracht, an denen sich viel erklären lässt. Diese Touren machen wir schon seit 2011, damals mit „BEN“, der leider durch den TÜV von uns getrennt wurde.
Gelia Eisert, Ausstellungen
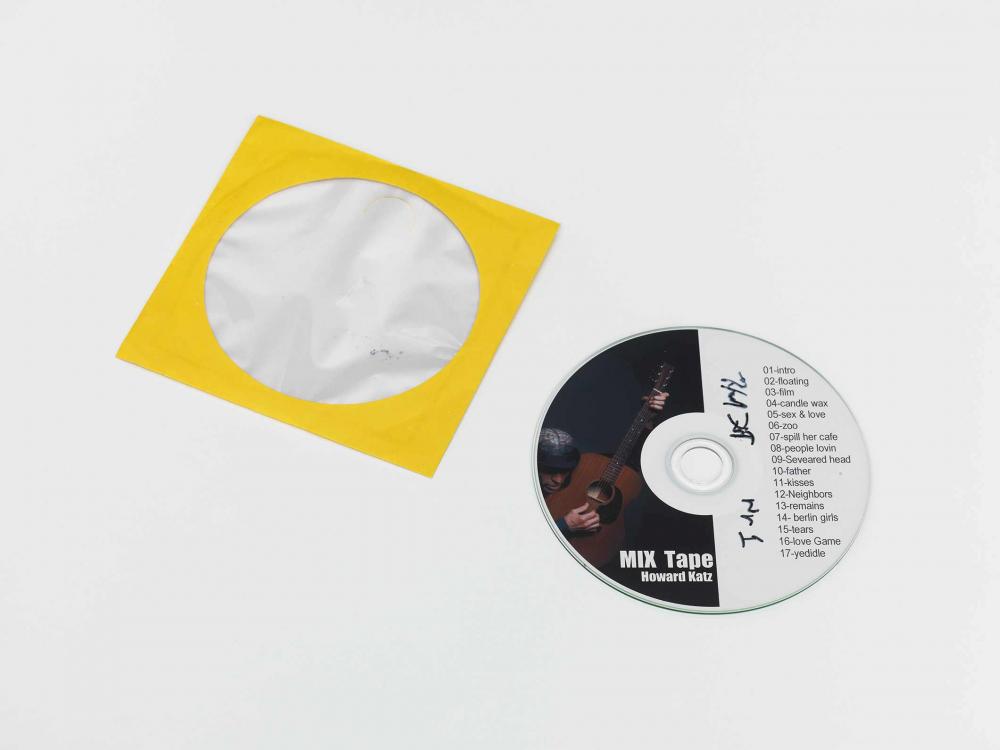
Howard Katz (*New York, USA), MIX Tape, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Energie galore: eine Begegnung mit Howard Katz
Wie schnell das immer geht: Gefühlt hatte die dritte Runde des Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin im Sommer 2015 doch eben erst begonnen, und dann sollte alles schon fast wieder ausverkauft und vorbei sein – 2.600 Werke! Wenn das kein Grund war, noch mal schnell bei Howard Katz vorbeizuflitzen und ihm ein paar Fragen zu stellen, zumal er als erster von bis dahin immerhin 22 beteiligten Künstler*innen mit Musik an den Start gegangen war …
Dagmar Ganßloser: Howard, du bedienst mit deiner künstlerischen Arbeit sehr unterschiedliche Genres: Du bist als Tänzer, Performer und Choreograph, aber auch als Bildender Künstler tätig, und außerdem bist du Singer-Songwriter. Im Kunstautomaten sind von dir nun die Werke Mix Tape sowie 4 Kurzfilme gelandet. Wie kam es zu dieser Auswahl?
Howard Katz: Mir war von Anfang an klar, dass ich mich im Kunstautomaten über meine Musik präsentieren möchte. Die 17 Songs auf Mix Tape sind über die letzten zwanzig Jahre hinweg entstanden und erzählen, wie auch 4 Kurzfilme, überwiegend von Erfahrungen, die ich gemacht habe, seit ich in Berlin lebe, also seit Mitte der 1990er Jahre. Alles ist sehr low profile produziert, und die Auswahl habe ich intuitiv, eben mit dem Herzen getroffen. Die vier Videos zu meinen Songs auf der DVD habe ich komplett selbst gemacht, mit meinem Telefon, und damit diesen Anlass auch als Gelegenheit genutzt, mal was Neues auszuprobieren.
Dagmar Ganßloser: Auf Mix Tape sprichst du deine potentiellen Hörer*innen direkt an, bittest sie um Feedback über deinen YouTube-Channel und ordnest deine Art zu erzählen als „very Jewish way of storytelling“ (typisch jüdische Art des Geschichtenerzählens) ein. Was meinst du damit?
Howard Katz: Ich bin in New York aufgewachsen und habe als Jude einer von vielen Minderheiten angehört, was alles andere als konfliktfrei war. Aber als ich hierher kam, wurde meine Aufmerksamkeit ziemlich stark auf mein Jüdischsein gelenkt. Meine Arbeiten wurden ein paar Mal abgelehnt, weil sie zu persönlich und zu emotional sind. Eine Frau sagte mal zu mir das ist ein bisschen peinlich, weil es so emotional ist. Wir brauchen Distanz
. Jüdisch heißt für mich: Wir sind ziemlich nah aneinander, manchmal schmerzt das, manchmal klebt es, und es gibt Reibung.
Dagmar Ganßloser: Seit wann schreibst du Songs?
Howard Katz: Mit zwölf oder dreizehn habe ich meine ersten Lieder geschrieben. Meine Musik von damals finde ich auch immer noch ganz charmant und schön, aber erst mit Mitte 40 habe ich dann wirklich meine Musik gefunden. Ich schreibe übrigens auch Lieder auf Deutsch…
Dagmar Ganßloser: Du beschäftigst dich neben Tanz und Musik auch mit Bodywork, also Körperarbeit. Machst du das auch schon so lange?
Howard Katz: Ich hab mich von klein auf sehr für Menschen interessiert und habe einfach sofort gesehen, wenn irgendwas an der Qualität ihrer Bewegungen oder auch ihrer Emotionen interessant war. Das ist mein Talent. Insofern wollte ich immer mit Menschen arbeiten, das war ziemlich klar. Mit acht Jahren wollte ich meine Eltern überreden, mich Tanzen lernen zu lassen, aber das haben sie nicht erlaubt. Eigentlich habe ich dann noch lange gewartet – weitere acht Jahre! – aber dann habe ich angefangen (lacht): Mit 16 bin ich von zu Hause ausgezogen, habe eine Tanzausbildung angefangen, nebenher gejobbt, und mit 17 hatte ich dann schon meine eigene Praxis in einem New Yorker Tanzstudio mit Reflexzonenmassage und anderen Massagetechniken.
Dagmar Ganßloser: Was mich sehr beeindruckt hat an der Fülle deiner Arbeiten ist, dass sie zwar sehr, sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem alle deine Handschrift tragen. Das gilt nicht nur für deine Musik, auch bei deinen Choreographien ist das so. Ich denke da beispielsweise an Kata. Und selbst bei dem von dir entwickelten Bewegungssystem „5qualities“ kann man das beobachten!
Howard Katz: Meine Handschrift ist immer ganz klar sichtbar, ich kann nicht genau sagen, warum das so ist. Andere machen immer das Gleiche, aber trotzdem erkennt man keine Handschrift, bei mir sieht man das immer. Meine künstlerische und meine therapeutische Arbeit sehe ich aber tatsächlich auch als Einheit.
Dagmar Ganßloser: Um was geht es bei „5qualities“ genau, verfolgst du damit das Ziel, einen Bewegungsstil zu vermitteln oder geht es dir um mehr?
Howard Katz: Angefangen hat es damit, dass ich ein Bewegungssystem gesucht habe, das jede*r erlernen kann. Ich habe natürlich mit viel mehr Qualitäten angefangen, mit 122! Und dann gemerkt, dass es eigentlich nur fünf Bewegungsqualitäten gibt: carry/tragen, fall/fallen, flow/fließen, throw/werfen, put/setzen – der Rest ist letztlich immer nur eine Mischung aus diesen fünf Basisqualitäten. Ich habe diese fünf Qualitäten dann in jedem Tanzstil und auch in jeder Kampfsportart wiedergefunden. „5qualities“ kann als Technik dabei helfen, Menschen auszubalancieren und damit den Prozess der Selbstentfaltung beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Ich heile also nicht, es geht mir eher um Ermutigung zur Selbsthilfe.
Dagmar Ganßloser: An was arbeitest du im Moment noch?
Howard Katz: Meine Frau Liz Williams und ich haben Ende Juni unsere erste Varieté-Show gemacht, NOIR. MusicCircusTheater, mit den besten Artist*innen Berlins, die sind echt phantastisch! Wir machen so richtig gefährliche Luftnummern, das habe ich in den letzten beiden Jahren gelernt und ich bin dabei ziemlich stark geworden. Für NOIR habe ich zudem mit meiner Band PostHolocaustPop – allerdings unter dem Namen PostTraumaticPop – die Musik gemacht. Inzwischen haben wir mit den Artist*innen eine Company gegründet, wir machen also weiter.
Dagmar Ganßloser, Digital & Publishing

Howard Katz (*New York, USA), 4 Kurzfilme, 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Energie galore: eine Begegnung mit Howard Katz
Wie schnell das immer geht: Gefühlt hatte die dritte Runde des Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin im Sommer 2015 doch eben erst begonnen, und dann sollte alles schon fast wieder ausverkauft und vorbei sein – 2.600 Werke! Wenn das kein Grund war, noch mal schnell bei Howard Katz vorbeizuflitzen und ihm ein paar Fragen zu stellen, zumal er als erster von bis dahin immerhin 22 beteiligten Künstler*innen mit Musik an den Start gegangen war …
Dagmar Ganßloser: Howard, du bedienst mit deiner künstlerischen Arbeit sehr unterschiedliche Genres: Du bist als Tänzer, Performer und Choreograph, aber auch als Bildender Künstler tätig, und außerdem bist du Singer-Songwriter. Im Kunstautomaten sind von dir nun die Werke Mix Tape sowie 4 Kurzfilme gelandet. Wie kam es zu dieser Auswahl?
Howard Katz: Mir war von Anfang an klar, dass ich mich im Kunstautomaten über meine Musik präsentieren möchte. Die 17 Songs auf Mix Tape sind über die letzten zwanzig Jahre hinweg entstanden und erzählen, wie auch 4 Kurzfilme, überwiegend von Erfahrungen, die ich gemacht habe, seit ich in Berlin lebe, also seit Mitte der 1990er Jahre. Alles ist sehr low profile produziert, und die Auswahl habe ich intuitiv, eben mit dem Herzen getroffen. Die vier Videos zu meinen Songs auf der DVD habe ich komplett selbst gemacht, mit meinem Telefon, und damit diesen Anlass auch als Gelegenheit genutzt, mal was Neues auszuprobieren.
Dagmar Ganßloser: Auf Mix Tape sprichst du deine potentiellen Hörer*innen direkt an, bittest sie um Feedback über deinen YouTube-Channel und ordnest deine Art zu erzählen als „very Jewish way of storytelling“ (typisch jüdische Art des Geschichtenerzählens) ein. Was meinst du damit?
Howard Katz: Ich bin in New York aufgewachsen und habe als Jude einer von vielen Minderheiten angehört, was alles andere als konfliktfrei war. Aber als ich hierher kam, wurde meine Aufmerksamkeit ziemlich stark auf mein Jüdischsein gelenkt. Meine Arbeiten wurden ein paar Mal abgelehnt, weil sie zu persönlich und zu emotional sind. Eine Frau sagte mal zu mir das ist ein bisschen peinlich, weil es so emotional ist. Wir brauchen Distanz
. Jüdisch heißt für mich: Wir sind ziemlich nah aneinander, manchmal schmerzt das, manchmal klebt es, und es gibt Reibung.
Dagmar Ganßloser: Seit wann schreibst du Songs?
Howard Katz: Mit zwölf oder dreizehn habe ich meine ersten Lieder geschrieben. Meine Musik von damals finde ich auch immer noch ganz charmant und schön, aber erst mit Mitte 40 habe ich dann wirklich meine Musik gefunden. Ich schreibe übrigens auch Lieder auf Deutsch…
Dagmar Ganßloser: Du beschäftigst dich neben Tanz und Musik auch mit Bodywork, also Körperarbeit. Machst du das auch schon so lange?
Howard Katz: Ich hab mich von klein auf sehr für Menschen interessiert und habe einfach sofort gesehen, wenn irgendwas an der Qualität ihrer Bewegungen oder auch ihrer Emotionen interessant war. Das ist mein Talent. Insofern wollte ich immer mit Menschen arbeiten, das war ziemlich klar. Mit acht Jahren wollte ich meine Eltern überreden, mich Tanzen lernen zu lassen, aber das haben sie nicht erlaubt. Eigentlich habe ich dann noch lange gewartet – weitere acht Jahre! – aber dann habe ich angefangen (lacht): Mit 16 bin ich von zu Hause ausgezogen, habe eine Tanzausbildung angefangen, nebenher gejobbt, und mit 17 hatte ich dann schon meine eigene Praxis in einem New Yorker Tanzstudio mit Reflexzonenmassage und anderen Massagetechniken.
Dagmar Ganßloser: Was mich sehr beeindruckt hat an der Fülle deiner Arbeiten ist, dass sie zwar sehr, sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem alle deine Handschrift tragen. Das gilt nicht nur für deine Musik, auch bei deinen Choreographien ist das so. Ich denke da beispielsweise an Kata. Und selbst bei dem von dir entwickelten Bewegungssystem „5qualities“ kann man das beobachten!
Howard Katz: Meine Handschrift ist immer ganz klar sichtbar, ich kann nicht genau sagen, warum das so ist. Andere machen immer das Gleiche, aber trotzdem erkennt man keine Handschrift, bei mir sieht man das immer. Meine künstlerische und meine therapeutische Arbeit sehe ich aber tatsächlich auch als Einheit.
Dagmar Ganßloser: Um was geht es bei „5qualities“ genau, verfolgst du damit das Ziel, einen Bewegungsstil zu vermitteln oder geht es dir um mehr?
Howard Katz: Angefangen hat es damit, dass ich ein Bewegungssystem gesucht habe, das jede*r erlernen kann. Ich habe natürlich mit viel mehr Qualitäten angefangen, mit 122! Und dann gemerkt, dass es eigentlich nur fünf Bewegungsqualitäten gibt: carry/tragen, fall/fallen, flow/fließen, throw/werfen, put/setzen – der Rest ist letztlich immer nur eine Mischung aus diesen fünf Basisqualitäten. Ich habe diese fünf Qualitäten dann in jedem Tanzstil und auch in jeder Kampfsportart wiedergefunden. „5qualities“ kann als Technik dabei helfen, Menschen auszubalancieren und damit den Prozess der Selbstentfaltung beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Ich heile also nicht, es geht mir eher um Ermutigung zur Selbsthilfe.
Dagmar Ganßloser: An was arbeitest du im Moment noch?
Howard Katz: Meine Frau Liz Williams und ich haben Ende Juni unsere erste Varieté-Show gemacht, NOIR. MusicCircusTheater, mit den besten Artist*innen Berlins, die sind echt phantastisch! Wir machen so richtig gefährliche Luftnummern, das habe ich in den letzten beiden Jahren gelernt und ich bin dabei ziemlich stark geworden. Für NOIR habe ich zudem mit meiner Band PostHolocaustPop – allerdings unter dem Namen PostTraumaticPop – die Musik gemacht. Inzwischen haben wir mit den Artist*innen eine Company gegründet, wir machen also weiter.
Dagmar Ganßloser, Digital & Publishing

Maria und Natalia Petschatnikov (*1973, Leningrad, Sowjetunion, heute: St. Petersburg, Russland), SPATZEN, Acrystal, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Spatzen, 4 Euro und die Stoffe der Stadt
Ende Mai 2015 gab es endlich die ersten fühlbaren Sonnenstrahlen in Berlin und damit eine perfekte Gelegenheit für mich, einen Ausflug nach Kreuzberg zu machen. Die Künstlerinnen Maria und Natalia Petschatnikov zeigten mir ihr Atelier und erzählten mir von den Spatzen und 4 Euro, ihren beiden Objekten im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin. Sie sprachen über ihre aktuellen Projekte und beantworteten mit viel Humor auch alle meine Fragen jenseits von Kunst.
Michaela Roßberg: Ihr arbeitet immer zusammen und seid Zwillinge, sogar eineiige. Wie ist es, wenn man so eng miteinander arbeitet? Wie entwickeln sich dabei Ideen und die Arbeit an Projekten? Schließlich hat doch immer nur eine Person das Idealbild eines fertigen Werkes vor Augen, oder?
Maria: Bei uns geschieht viel durch Dialog. Es ist nicht so, dass eine von uns die Idee hat und nach der Fertigstellung des Projekts sagen kann: Das ist meine Idee gewesen
. Bei uns entstehen Arbeiten in einem gemeinsamen Prozess, wir gehen z.B. zusammen durch die Stadt und sehen interessante Dinge, die uns zum Nachdenken anregen. Wir sprechen viel über diese Sachen und daraus entstehen dann unsere gemeinsamen Ideen.
Natalia: Wir beschäftigen uns häufig mit der urbanen Umwelt. Weil wir viel zusammen beobachten, haben viele unserer Arbeiten die sogenannten kleinen Dinge des Alltags, wie Tiere oder den öffentlichen Nahverkehr, zum Thema.
Michaela Roßberg: Was habt ihr gedacht, als das Jüdische Museum Berlin mit der Idee auf euch zugekommen ist, sich an der neuen Reihe des Kunstautomaten zu beteiligen? Warum habt ihr euch dafür entschieden mitzumachen?
Natalia: Zunächst hatten wir großen Respekt vor der Institution des Museums. Aber das Projekt gibt uns die Möglichkeit, etwas über uns und unsere Arbeit zu erzählen. Wir haben 400 Objekte für den Automaten angefertigt, das bedeutet, dass wir vielleicht 400 Leute mit unserer Kunst erreichen. Dieses Gefühl, mit der eigenen Arbeit Menschen zu erreichen, ist für Künstler*innen sehr wichtig.
Maria: Wir finden die Idee auch einfach sehr gut. Kunst ist oft elitär: Wir können uns die Arbeiten unserer Freunde nicht leisten, die können sich unsere nicht leisten. Das Tolle am Kunstautomaten ist, dass er eine schöne Brücke zwischen der Kunst und den Museumsbesuchern baut. Wir machen auch keinen Unterschied zwischen einer Arbeit für vier Euro oder 400 Euro, sondern arbeiten mit der gleichen Mühe daran. Uns hat zudem die Wertschätzung und der Respekt uns Künstlerinnen gegenüber gefreut, und wie viel Mühe sich die zuständigen Personen gemacht haben, obwohl die Werke nur 4 Euro pro Stück kosten.
Michaela Roßberg: Normalerweise fertigt man ja auch nur ein oder wenige Stücke eines Objekts an und nicht 200, wie für den Kunstautomaten. Frustriert diese Menge einen nicht irgendwann?
Natalia: Ganz im Gegenteil. Gerade durch das Arbeiten an mehreren Werken des gleichen Typs ändert sich dein Bezug zum Werk, du fängst an, damit zu spielen, du erlebst es anders.
Michaela Roßberg: Auch beim 150sten Mal? (Beide lachen)
Maria: Bei den Spatzen für den Kunstautomaten ging es ganz gut, denn die haben wir ja gegossen. Sie haben auch viel Arbeit gemacht, aber nicht so viel wie die Bilder. Aber gerade die 4 Euro-Bilder haben wir ja aus einem bestimmten Grund gemalt, sie haben eine konzeptuelle Ebene. Es ist für uns wie ein Kommentar dazu, was gerade in unserer Branche passiert. Wer entscheidet, was Gemälde oder Kunstobjekte wert sind? Wer entscheidet über die Schätzung?
Natalia: So bekommen Besucher*innen eine Arbeit von uns, die vier Euro kostet, und für dieses Geld erhält man auch vier Euro zurück, nur eben als Gemälde, das die Münzen zeigt.
Michaela Roßberg: Jedem Objekt des Automaten liegt ein Zettel mit Informationen zu den Künstler*innen und der Objektidee bei. Bei euren beiden Werken ist zu lesen, dass eurer Meinung nach kleine Dinge oft größere soziale und historische Tendenzen widerspiegeln. Ich finde das sehr spannend, könnt ihr das näher erklären?
Natalia: Gerade in Berlin kann man diese Tendenzen zum Beispiel an Verkehrsmitteln wie der Tram sehen. Seit den siebziger Jahren gab es im Westen keine Tram mehr, sie galt als zu laut und störend. Im Osten dagegen war das Netz gut ausgebaut. Nach der Wende hat man erkannt, dass mit der Tram ohne Stau durch die Stadt zu kommen ein enorm großer Gewinn an Lebensqualität ist und es auch umweltschonender ist. Mittlerweile wird das Tramnetz stark ausgebaut.
Maria: Oder ganz simpel: Der Coffee to go. Nicht auf Deutsch „zum Mitnehmen“, sondern „to go“. Wie haben sich Menschen und die Gesellschaft entwickelt, dass sie plötzlich begeistert ihren Kaffee im Gehen trinken? Warum ist vorher noch nie jemand auf die Idee gekommen, mit seinem Kaffee in der Hand auf die Straße zu gehen? Vorher hat man in Ruhe irgendwo gesessen.
Wir versuchen auch bemerkenswerte Kleinigkeiten herauszuarbeiten, die unserer Meinung nach eine solche Tendenz abbilden. Ähnlich wie Archäolog*innen oder Anthropolog*innen versuchen wir, solche Objekte sichtbar zu machen. Stell dir vor, wie es ist, wenn man in hunderten von Jahren einen Coffee to go-Becher findet. Wahrscheinlich würden Forscher versuchen, anhand dessen Rückschlüsse auf die Gesellschaft in 2015 zu ziehen.
Michaela Roßberg: Woran arbeitet ihr momentan? Ist das da ein Ausschnitt vom Flohmarkt am Mauerpark? Zumindest kann ich als Fußballfan das Jahnstadion des BFC erkennen.
Natalia: Ja, wir haben auf dem Flohmarkt genau die Szene gesehen, wie du sie hier an der Wand siehst, haben sie fotografiert und dann mit Öl auf viele kleine Metallplatten gemalt. Die alten Möbel, die dort verkauft werden, und deren Spiegelungen in den Pfützen auf dem Gelände fanden wir faszinierend.
Maria: Die Arbeit ist ein Teil des Projekts Berlin & Berlin. Wir haben diese aus Bildern und Objekten bestehende Installation im April auf der Deutschen Woche in St. Petersburg gezeigt. Wir finden Flohmärkte so interessant, weil sie ein Abbild der momentanen Gesellschaft sind und vieles zusammenbringen, was sonst nie zusammengekommen wäre. Wie eine Barbie zusammen mit einer Matrjoschka. Beide sind sinnbildlich für verschiedene Welten, liegen nun aber zum Verkauf zusammen in der Kiste.
Michaela Roßberg: Die meisten eurer Arbeiten haben mit Berlin zu tun. Was bedeutet die Stadt für euch?
Maria: Wir versuchen jeden Ort, an dem wir gelebt haben, visuell zu erforschen. Berlin ist dabei aber etwas Besonderes, ich finde die Stadt hat unglaublich viele verschiedene Ebenen. Die sind nicht alle fröhlich und lustig, aber je tiefer man geht, desto mehr Geschichten öffnet man.
Natalia: Wir sind keine Politikerinnen oder Historikerinnen, wir betrachten diese Ebenen anders, eher visuell. Als wir hergezogen sind, war es für uns auch klar, dass wir im Osten der Stadt wohnen wollen.
Maria: Nach der Wende war der Osten der Stadt für Künstler*innen und junge Leute spannender, viel günstiger und bot mehr Möglichkeiten. Es entstanden dort viele Kunsthäuser, und neue Galerien konnten sich erst noch etablieren. Diese Energie fühlen wir immer noch. Seit Neuestem entdecken wir aber auch Westberlin. Man kann dort spannende Geschichtsebenen und tolle Kunstorte finden. Also, Stoff für neue Projekte werden wir in Berlin immer haben.
Michaela Roßberg, Wechselausstellungen

Maria und Natalia Petschatnikov (*1973, Leningrad, Sowjetunion, heute: St. Petersburg, Russland), 4 Euro; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Spatzen, 4 Euro und die Stoffe der Stadt
Ende Mai 2015 gab es endlich die ersten fühlbaren Sonnenstrahlen in Berlin und damit eine perfekte Gelegenheit für mich, einen Ausflug nach Kreuzberg zu machen. Die Künstlerinnen Maria und Natalia Petschatnikov zeigten mir ihr Atelier und erzählten mir von den Spatzen und 4 Euro, ihren beiden Objekten im Kunstautomaten des Jüdischen Museums Berlin. Sie sprachen über ihre aktuellen Projekte und beantworteten mit viel Humor auch alle meine Fragen jenseits von Kunst.
Michaela Roßberg: Ihr arbeitet immer zusammen und seid Zwillinge, sogar eineiige. Wie ist es, wenn man so eng miteinander arbeitet? Wie entwickeln sich dabei Ideen und die Arbeit an Projekten? Schließlich hat doch immer nur eine Person das Idealbild eines fertigen Werkes vor Augen, oder?
Maria: Bei uns geschieht viel durch Dialog. Es ist nicht so, dass eine von uns die Idee hat und nach der Fertigstellung des Projekts sagen kann: Das ist meine Idee gewesen
. Bei uns entstehen Arbeiten in einem gemeinsamen Prozess, wir gehen z.B. zusammen durch die Stadt und sehen interessante Dinge, die uns zum Nachdenken anregen. Wir sprechen viel über diese Sachen und daraus entstehen dann unsere gemeinsamen Ideen.
Natalia: Wir beschäftigen uns häufig mit der urbanen Umwelt. Weil wir viel zusammen beobachten, haben viele unserer Arbeiten die sogenannten kleinen Dinge des Alltags, wie Tiere oder den öffentlichen Nahverkehr, zum Thema.
Michaela Roßberg: Was habt ihr gedacht, als das Jüdische Museum Berlin mit der Idee auf euch zugekommen ist, sich an der neuen Reihe des Kunstautomaten zu beteiligen? Warum habt ihr euch dafür entschieden mitzumachen?
Natalia: Zunächst hatten wir großen Respekt vor der Institution des Museums. Aber das Projekt gibt uns die Möglichkeit, etwas über uns und unsere Arbeit zu erzählen. Wir haben 400 Objekte für den Automaten angefertigt, das bedeutet, dass wir vielleicht 400 Leute mit unserer Kunst erreichen. Dieses Gefühl, mit der eigenen Arbeit Menschen zu erreichen, ist für Künstler*innen sehr wichtig.
Maria: Wir finden die Idee auch einfach sehr gut. Kunst ist oft elitär: Wir können uns die Arbeiten unserer Freunde nicht leisten, die können sich unsere nicht leisten. Das Tolle am Kunstautomaten ist, dass er eine schöne Brücke zwischen der Kunst und den Museumsbesuchern baut. Wir machen auch keinen Unterschied zwischen einer Arbeit für vier Euro oder 400 Euro, sondern arbeiten mit der gleichen Mühe daran. Uns hat zudem die Wertschätzung und der Respekt uns Künstlerinnen gegenüber gefreut, und wie viel Mühe sich die zuständigen Personen gemacht haben, obwohl die Werke nur 4 Euro pro Stück kosten.
Michaela Roßberg: Normalerweise fertigt man ja auch nur ein oder wenige Stücke eines Objekts an und nicht 200, wie für den Kunstautomaten. Frustriert diese Menge einen nicht irgendwann?
Natalia: Ganz im Gegenteil. Gerade durch das Arbeiten an mehreren Werken des gleichen Typs ändert sich dein Bezug zum Werk, du fängst an, damit zu spielen, du erlebst es anders.
Michaela Roßberg: Auch beim 150sten Mal? (Beide lachen)
Maria: Bei den Spatzen für den Kunstautomaten ging es ganz gut, denn die haben wir ja gegossen. Sie haben auch viel Arbeit gemacht, aber nicht so viel wie die Bilder. Aber gerade die 4 Euro-Bilder haben wir ja aus einem bestimmten Grund gemalt, sie haben eine konzeptuelle Ebene. Es ist für uns wie ein Kommentar dazu, was gerade in unserer Branche passiert. Wer entscheidet, was Gemälde oder Kunstobjekte wert sind? Wer entscheidet über die Schätzung?
Natalia: So bekommen Besucher*innen eine Arbeit von uns, die vier Euro kostet, und für dieses Geld erhält man auch vier Euro zurück, nur eben als Gemälde, das die Münzen zeigt.
Michaela Roßberg: Jedem Objekt des Automaten liegt ein Zettel mit Informationen zu den Künstler*innen und der Objektidee bei. Bei euren beiden Werken ist zu lesen, dass eurer Meinung nach kleine Dinge oft größere soziale und historische Tendenzen widerspiegeln. Ich finde das sehr spannend, könnt ihr das näher erklären?
Natalia: Gerade in Berlin kann man diese Tendenzen zum Beispiel an Verkehrsmitteln wie der Tram sehen. Seit den siebziger Jahren gab es im Westen keine Tram mehr, sie galt als zu laut und störend. Im Osten dagegen war das Netz gut ausgebaut. Nach der Wende hat man erkannt, dass mit der Tram ohne Stau durch die Stadt zu kommen ein enorm großer Gewinn an Lebensqualität ist und es auch umweltschonender ist. Mittlerweile wird das Tramnetz stark ausgebaut.
Maria: Oder ganz simpel: Der Coffee to go. Nicht auf Deutsch „zum Mitnehmen“, sondern „to go“. Wie haben sich Menschen und die Gesellschaft entwickelt, dass sie plötzlich begeistert ihren Kaffee im Gehen trinken? Warum ist vorher noch nie jemand auf die Idee gekommen, mit seinem Kaffee in der Hand auf die Straße zu gehen? Vorher hat man in Ruhe irgendwo gesessen.
Wir versuchen auch bemerkenswerte Kleinigkeiten herauszuarbeiten, die unserer Meinung nach eine solche Tendenz abbilden. Ähnlich wie Archäolog*innen oder Anthropolog*innen versuchen wir, solche Objekte sichtbar zu machen. Stell dir vor, wie es ist, wenn man in hunderten von Jahren einen Coffee to go-Becher findet. Wahrscheinlich würden Forscher versuchen, anhand dessen Rückschlüsse auf die Gesellschaft in 2015 zu ziehen.
Michaela Roßberg: Woran arbeitet ihr momentan? Ist das da ein Ausschnitt vom Flohmarkt am Mauerpark? Zumindest kann ich als Fußballfan das Jahnstadion des BFC erkennen.
Natalia: Ja, wir haben auf dem Flohmarkt genau die Szene gesehen, wie du sie hier an der Wand siehst, haben sie fotografiert und dann mit Öl auf viele kleine Metallplatten gemalt. Die alten Möbel, die dort verkauft werden, und deren Spiegelungen in den Pfützen auf dem Gelände fanden wir faszinierend.
Maria: Die Arbeit ist ein Teil des Projekts Berlin & Berlin. Wir haben diese aus Bildern und Objekten bestehende Installation im April auf der Deutschen Woche in St. Petersburg gezeigt. Wir finden Flohmärkte so interessant, weil sie ein Abbild der momentanen Gesellschaft sind und vieles zusammenbringen, was sonst nie zusammengekommen wäre. Wie eine Barbie zusammen mit einer Matrjoschka. Beide sind sinnbildlich für verschiedene Welten, liegen nun aber zum Verkauf zusammen in der Kiste.
Michaela Roßberg: Die meisten eurer Arbeiten haben mit Berlin zu tun. Was bedeutet die Stadt für euch?
Maria: Wir versuchen jeden Ort, an dem wir gelebt haben, visuell zu erforschen. Berlin ist dabei aber etwas Besonderes, ich finde die Stadt hat unglaublich viele verschiedene Ebenen. Die sind nicht alle fröhlich und lustig, aber je tiefer man geht, desto mehr Geschichten öffnet man.
Natalia: Wir sind keine Politikerinnen oder Historikerinnen, wir betrachten diese Ebenen anders, eher visuell. Als wir hergezogen sind, war es für uns auch klar, dass wir im Osten der Stadt wohnen wollen.
Maria: Nach der Wende war der Osten der Stadt für Künstler*innen und junge Leute spannender, viel günstiger und bot mehr Möglichkeiten. Es entstanden dort viele Kunsthäuser, und neue Galerien konnten sich erst noch etablieren. Diese Energie fühlen wir immer noch. Seit Neuestem entdecken wir aber auch Westberlin. Man kann dort spannende Geschichtsebenen und tolle Kunstorte finden. Also, Stoff für neue Projekte werden wir in Berlin immer haben.
Michaela Roßberg, Wechselausstellungen
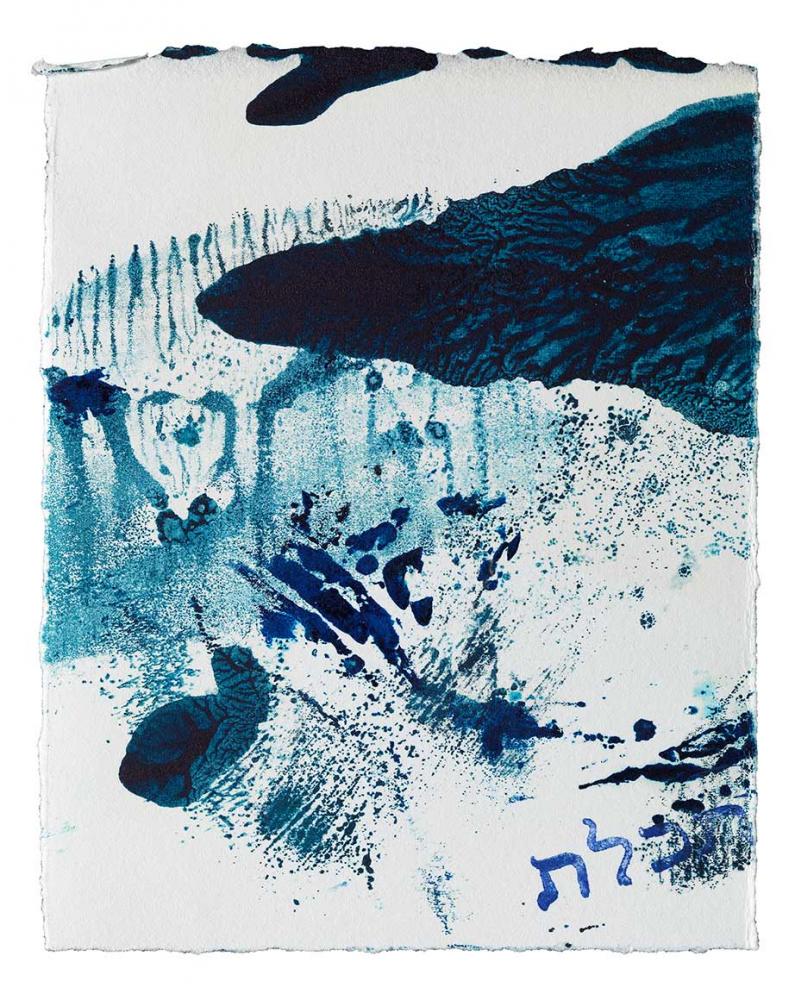
Deborah S. Phillips (lebt und arbeitet in Berlin), T'cheletfragmente, Lithographie, Monotypie & Stempeldruck, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Farben des Lichts
Ein Besuch in der Atelierwohnung von Deborah S. Phillips in Berlin-Neukölln, 2015. Die Künstlerin trägt heute Blau, nur ihre Schuhe sind Grün. Dass die Künstlerin seit fünf Jahren die Farbe Blau erforscht und sich nun allmählich dem Grün zuwendet, spiegelt sich nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch in der Kleidung.
Rot war die Farbe, der sich Deborah Phillips zuerst mit Leidenschaft zuwandte. Der Bibeltext, den sie als Zwölfjährige anlässlich ihrer Bat Mizwa in der Synagoge vorlas, handelte von der Roten Kuh – eine Geschichte, die sie lange nicht losließ. Sie erzählt von einem seltenen Tier, das verbrannt werden muss, um mit seiner Asche die Menschen von ihren Sünden zu reinigen. Erst dann dürfen diese den Tempel in Jerusalem betreten. Sehr viel später mündete Deborah Phillips Nachdenken über die Farbe Rot und deren kulturelle Bedeutungen in eine ihrer zauberhaften Papierarbeiten, Rotbuch. Lange Reisen in den Iran, nach Indien und Zentralasien sowie eine Affinität zu den Kulturen des Islam spiegeln sich in dem Band.
Das vierte Buch Moses und das Blaubuch
Jetzt liegt auch das Blaubuch vor. Bei meinem Besuch darf ich in den gerade fertig gestellten Künstlerinnenbüchern blättern, insgesamt sind es sieben Unikate. Sie enthalten Lithographien, Monotypien und Fotocollagen, Bleisatz und Stempeldruck, aber auch kleine Zeichnungen aus Nagellack in allerhand Blautönen.
Deborah Phillips Faszination für die Farbe Blau hat ihren Ursprung ebenfalls in der Bibel: Das vierte Buch Moses enthält die Anweisung, an den vier Ecken des Gebetsmantels Fäden anzubringen, um sich stets an die Gebote Gottes zu erinnern. Einige der Fäden sollten blau, auf Hebräisch tchelet, gefärbt sein. Weil sich später nicht mehr ermitteln ließ, welche Farbe gemeint war, hoben die Gelehrten das Gebot auf, und alle Fäden sind seitdem weiß. Die rabbinischen Diskussionen über tchelet beschäftigten Deborah Phillips schon in ihrer Jugend. In Israel bezeichnet tchelet heute – ganz profan und doch überirdisch – die Farbe des Himmels.
Künstlerin, Gewürzberaterin
Farben und Klänge, Buchstaben, Gewürze und Gerüche fließen in Deborah Phillips künstlerischer Arbeit zusammen – was daraus wird, bleibt auch für sie selbst immer wieder ein Abenteuer. Während sie am Blaubuch arbeitete, entstanden sozusagen als Nebenprodukte die Monotypien, die wir ab April 2015 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin anboten. Manche der kleinen Blätter tragen nur einen hebräischen Schriftzug, nämlich tchelet, auf andere hat die Künstlerin ein zweites Wort gestempelt, argaman. Es bedeutet „purpur“, eine königliche Farbe, in die sich die Priester im antiken Tempel in Jerusalem kleideten.
Neben ihren Papierarbeiten entwickelt Deborah Phillips Filme, Installationen und Performances. Sie arbeitet als Übersetzerin, koordiniert Kulturprojekte und ist eine hervorragende Köchin und „Gewürzberaterin“.
Übrigens: Nicht nur die Farben spielen in Deborah Phillips (Künstlerinnen-) Leben eine überragende Rolle, sondern auch die berüchtigte Neuköllner Hermannstraße. Denn der Mädchenname ihrer Mutter war Herman, und sie selbst lebt schon lange in der Nähe der Hermannstraße und des Hermannplatzes. Ein Projekt mit dem Namen HERMAN(N) ist aus dieser Koinzidenz entstanden.
Die Farben, Gerüche, Stimmen und Geräusche, zart, grell und wild zugleich, begleiten mich auf dem Fußweg von Deborahs Atelierwohnung entlang der Hermannstraße noch bis zum U-Bahnhof.
Maren Krüger, Ausstellungen
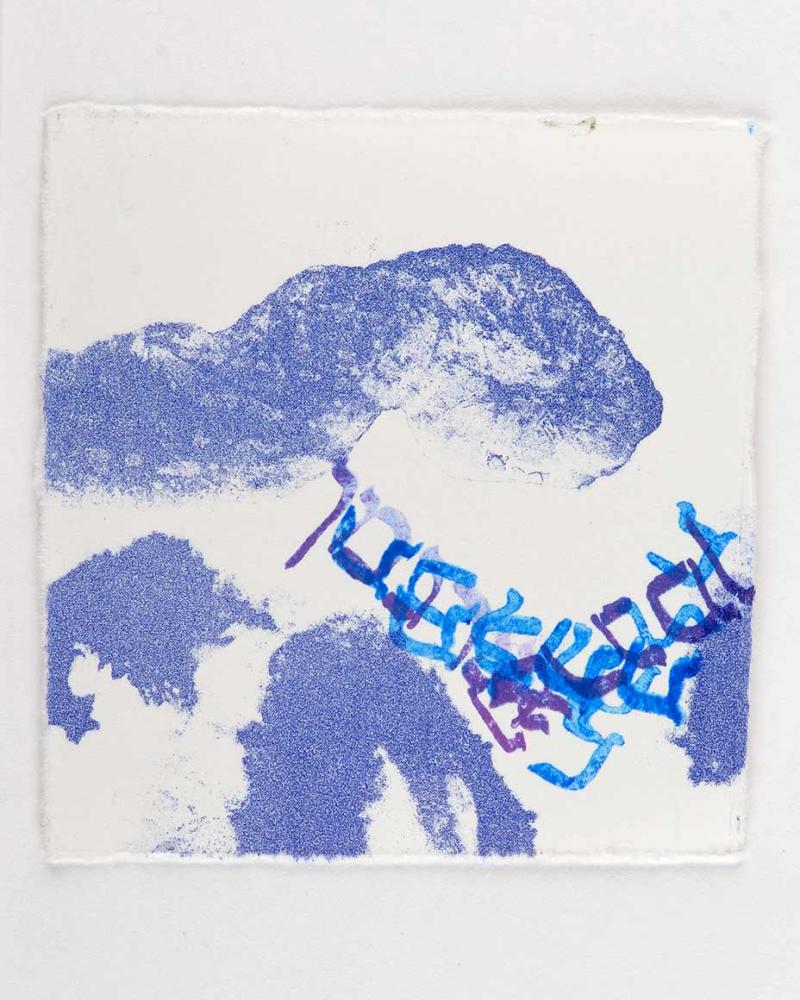
Deborah S. Phillips (lebt und arbeitet in Berlin), T’chelet ve Argaman, Lithographie & Stempeldruck, 2015; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Oliver Stratz.
Farben des Lichts
Ein Besuch in der Atelierwohnung von Deborah S. Phillips in Berlin-Neukölln, 2015. Die Künstlerin trägt heute Blau, nur ihre Schuhe sind Grün. Dass die Künstlerin seit fünf Jahren die Farbe Blau erforscht und sich nun allmählich dem Grün zuwendet, spiegelt sich nicht nur in ihrer Kunst, sondern auch in der Kleidung.
Rot war die Farbe, der sich Deborah Phillips zuerst mit Leidenschaft zuwandte. Der Bibeltext, den sie als Zwölfjährige anlässlich ihrer Bat Mizwa in der Synagoge vorlas, handelte von der Roten Kuh – eine Geschichte, die sie lange nicht losließ. Sie erzählt von einem seltenen Tier, das verbrannt werden muss, um mit seiner Asche die Menschen von ihren Sünden zu reinigen. Erst dann dürfen diese den Tempel in Jerusalem betreten. Sehr viel später mündete Deborah Phillips Nachdenken über die Farbe Rot und deren kulturelle Bedeutungen in eine ihrer zauberhaften Papierarbeiten, Rotbuch. Lange Reisen in den Iran, nach Indien und Zentralasien sowie eine Affinität zu den Kulturen des Islam spiegeln sich in dem Band.
Das vierte Buch Moses und das Blaubuch
Jetzt liegt auch das Blaubuch vor. Bei meinem Besuch darf ich in den gerade fertig gestellten Künstlerinnenbüchern blättern, insgesamt sind es sieben Unikate. Sie enthalten Lithographien, Monotypien und Fotocollagen, Bleisatz und Stempeldruck, aber auch kleine Zeichnungen aus Nagellack in allerhand Blautönen.
Deborah Phillips Faszination für die Farbe Blau hat ihren Ursprung ebenfalls in der Bibel: Das vierte Buch Moses enthält die Anweisung, an den vier Ecken des Gebetsmantels Fäden anzubringen, um sich stets an die Gebote Gottes zu erinnern. Einige der Fäden sollten blau, auf Hebräisch tchelet, gefärbt sein. Weil sich später nicht mehr ermitteln ließ, welche Farbe gemeint war, hoben die Gelehrten das Gebot auf, und alle Fäden sind seitdem weiß. Die rabbinischen Diskussionen über tchelet beschäftigten Deborah Phillips schon in ihrer Jugend. In Israel bezeichnet tchelet heute – ganz profan und doch überirdisch – die Farbe des Himmels.
Künstlerin, Gewürzberaterin
Farben und Klänge, Buchstaben, Gewürze und Gerüche fließen in Deborah Phillips künstlerischer Arbeit zusammen – was daraus wird, bleibt auch für sie selbst immer wieder ein Abenteuer. Während sie am Blaubuch arbeitete, entstanden sozusagen als Nebenprodukte die Monotypien, die wir ab April 2015 im Kunstautomaten in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin anboten. Manche der kleinen Blätter tragen nur einen hebräischen Schriftzug, nämlich tchelet, auf andere hat die Künstlerin ein zweites Wort gestempelt, argaman. Es bedeutet „purpur“, eine königliche Farbe, in die sich die Priester im antiken Tempel in Jerusalem kleideten.
Neben ihren Papierarbeiten entwickelt Deborah Phillips Filme, Installationen und Performances. Sie arbeitet als Übersetzerin, koordiniert Kulturprojekte und ist eine hervorragende Köchin und „Gewürzberaterin“.
Übrigens: Nicht nur die Farben spielen in Deborah Phillips (Künstlerinnen-) Leben eine überragende Rolle, sondern auch die berüchtigte Neuköllner Hermannstraße. Denn der Mädchenname ihrer Mutter war Herman, und sie selbst lebt schon lange in der Nähe der Hermannstraße und des Hermannplatzes. Ein Projekt mit dem Namen HERMAN(N) ist aus dieser Koinzidenz entstanden.
Die Farben, Gerüche, Stimmen und Geräusche, zart, grell und wild zugleich, begleiten mich auf dem Fußweg von Deborahs Atelierwohnung entlang der Hermannstraße noch bis zum U-Bahnhof.
Maren Krüger, Ausstellungen
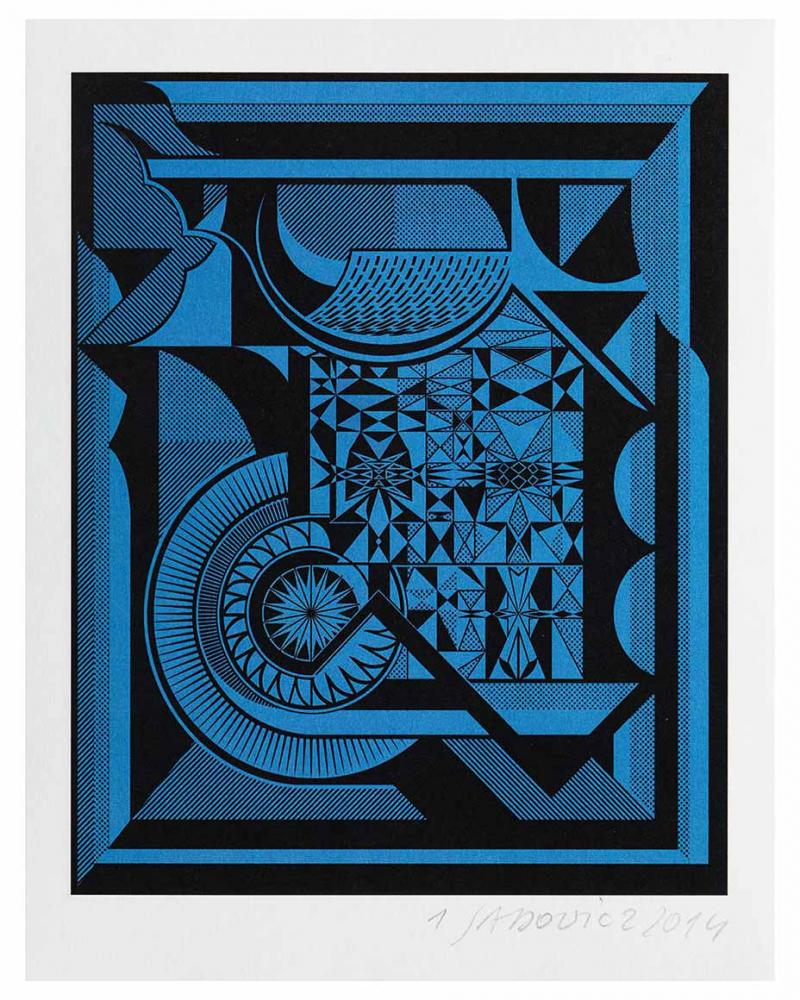
Georg Sadowicz (*1972, Legnica, Polen), Die Mühle, Offsetdruck, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Die Flucht vor dem Fluchtpunkt
In Berlin-Hohenschönhausen bin ich mit Georg Sadowicz in seinem Atelier verabredet. Der heute in Berlin lebende Künstler wurde im polnischen Liegnitz nahe der deutschen Grenze geboren. Zwei seiner Werke, Vorstudien zu größeren Arbeiten, waren 2015 in limitierter Auflage für die Besucher des Jüdischen Museums Berlin im Kunstautomaten in der Dauerausstellung zu erwerben: Sie heißen Der Vorbeter und Die Mühle. Etwa hundert Meter vom Atelierkomplex entfernt befindet sich die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen mit den Räumlichkeiten der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt der Staatsicherheit der DDR. Ihr Anblick löst ein beklemmendes Gefühl bei mir aus, das sich erst verflüchtigt, als ich Sadowiczʼ Atelier betrete.
Von der Malerei zum Druck
Georg Sadowicz hat eine bewegte Lebensgeschichte. Als er sechzehn Jahre alt war, zog seine Familie aus Polen ins westdeutsche Nürnberg. Nach der Schule studierte er Bildende Kunst in Dresden und war Meisterschüler bei Ralf Kerbach, der an der dortigen Hochschule für Bildende Künste Malerei und Grafik lehrte. Wichtig war für ihn auch sein Mentor und Förderer Professor Max Uhlig. Erst um 2000 herum verschlug es Sadowicz dauerhaft nach Berlin, wo sich ihm künstlerische und finanzielle Möglichkeiten auftaten, die ihm in anderen Städten versperrt blieben.
Unmittelbar nach dem Studium vertiefte sich Sadowicz zunächst in die Kunst der Malerei. Inzwischen hat er sich dem Linolschnitt zugewandt. In der Produktion von Linolschnitten durchläuft jedes Bild einen komplexen Herstellungsprozess von der ersten Vorlage über den Negativschnitt in das Material bis hin zur finalen Färbung. Die Ergebnisse sind nicht immer vorhersehbar: „Manche Vorlagen liegen seit mehr als einem Jahr in meinem Atelier und andere stellen sich erst im Verlauf des Bedruckens als gescheitert heraus. Man könnte das Entstehen meiner Kunstwerke mit einem Schachspiel vergleichen. Ich plane zwar die Züge im Voraus und will gewinnen. Sie können aber auch falsch sein. Das merkt man erst am Ende des Spiels
“, beschreibt Sadowicz die Schwierigkeiten dieses Prozesses und fügt hinzu, dass Scheitern jedoch wichtig sei, denn daraus lerne er viel.
Ambivalente Raumaufteilung
Die Kunstform des Linolschnitts entspricht Sadowiczʼ allgemeinem Kunstverständnis. Mit Ausnahme der Werke für den Kunstautomaten, Offsetdrucke die auf kleinen Linolschnitten basieren, fertigt der Künstler meist großformatige Linolschnitte an. Wichtig ist ihm dabei, dass hier „das übliche perspektivische Raumkonstrukt von klassischer Kunst beim Betrachten nicht greift
“. Die traditionelle Aufteilung in Vordergrund, Mitte und Hintergrund wird in seinen Arbeiten permanent hinterfragt. Unterstützt wird dies dadurch, dass es in den allermeisten Kunstwerken von Sadowicz keinen Fluchtpunkt gibt: „Ich ordne alle Elemente im sich wiederholenden Wechselspiel rhythmisch so an, dass die Raumverortung immer ambivalent bleibt. Vieles befindet sich gleichzeitig auf allen drei Ebenen: Vorne, Hinten und in der Mitte.
“ So erscheinen viele Formen als Teil eines größeren Ganzen, das sich wiederum in immer detailliertere Symbole und Szenen zu unterteilen scheint. Das lässt sich auch bei Sadowiczʼ kleinformatigen Werken für den Kunstautomaten beobachten.
Mein interessanter Besuch in Georg Sadowiczʼ Atelier dauert in meinen Gedanken fort – nicht zuletzt, weil er mir einen Einblick in die prekäre Situation vieler Berliner Künstlerinnen und Künstler gegeben hat: Sadowicz erzählte mir von seinem früheren Atelier in Berlin Kreuzberg, das mit der Zeit zu teuer wurde. Sein Umzug in die alte Fabrikhalle in Hohenschönhausen ist also auch ein Sinnbild für die räumliche Verdrängung der Berliner Künstlerinnen und Künstler aus dem Zentrum der Stadt an die Peripherie.
Kilian Gärtner, Jewish Places

Georg Sadowicz (*1972, Legnica, Polen), Der Vorbeter, Offsetdruck, 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Die Flucht vor dem Fluchtpunkt
In Berlin-Hohenschönhausen bin ich mit Georg Sadowicz in seinem Atelier verabredet. Der heute in Berlin lebende Künstler wurde im polnischen Liegnitz nahe der deutschen Grenze geboren. Zwei seiner Werke, Vorstudien zu größeren Arbeiten, waren 2015 in limitierter Auflage für die Besucher des Jüdischen Museums Berlin im Kunstautomaten in der Dauerausstellung zu erwerben: Sie heißen Der Vorbeter und Die Mühle. Etwa hundert Meter vom Atelierkomplex entfernt befindet sich die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen mit den Räumlichkeiten der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt der Staatsicherheit der DDR. Ihr Anblick löst ein beklemmendes Gefühl bei mir aus, das sich erst verflüchtigt, als ich Sadowiczʼ Atelier betrete.
Von der Malerei zum Druck
Georg Sadowicz hat eine bewegte Lebensgeschichte. Als er sechzehn Jahre alt war, zog seine Familie aus Polen ins westdeutsche Nürnberg. Nach der Schule studierte er Bildende Kunst in Dresden und war Meisterschüler bei Ralf Kerbach, der an der dortigen Hochschule für Bildende Künste Malerei und Grafik lehrte. Wichtig war für ihn auch sein Mentor und Förderer Professor Max Uhlig. Erst um 2000 herum verschlug es Sadowicz dauerhaft nach Berlin, wo sich ihm künstlerische und finanzielle Möglichkeiten auftaten, die ihm in anderen Städten versperrt blieben.
Unmittelbar nach dem Studium vertiefte sich Sadowicz zunächst in die Kunst der Malerei. Inzwischen hat er sich dem Linolschnitt zugewandt. In der Produktion von Linolschnitten durchläuft jedes Bild einen komplexen Herstellungsprozess von der ersten Vorlage über den Negativschnitt in das Material bis hin zur finalen Färbung. Die Ergebnisse sind nicht immer vorhersehbar: „Manche Vorlagen liegen seit mehr als einem Jahr in meinem Atelier und andere stellen sich erst im Verlauf des Bedruckens als gescheitert heraus. Man könnte das Entstehen meiner Kunstwerke mit einem Schachspiel vergleichen. Ich plane zwar die Züge im Voraus und will gewinnen. Sie können aber auch falsch sein. Das merkt man erst am Ende des Spiels
“, beschreibt Sadowicz die Schwierigkeiten dieses Prozesses und fügt hinzu, dass Scheitern jedoch wichtig sei, denn daraus lerne er viel.
Ambivalente Raumaufteilung
Die Kunstform des Linolschnitts entspricht Sadowiczʼ allgemeinem Kunstverständnis. Mit Ausnahme der Werke für den Kunstautomaten, Offsetdrucke die auf kleinen Linolschnitten basieren, fertigt der Künstler meist großformatige Linolschnitte an. Wichtig ist ihm dabei, dass hier „das übliche perspektivische Raumkonstrukt von klassischer Kunst beim Betrachten nicht greift
“. Die traditionelle Aufteilung in Vordergrund, Mitte und Hintergrund wird in seinen Arbeiten permanent hinterfragt. Unterstützt wird dies dadurch, dass es in den allermeisten Kunstwerken von Sadowicz keinen Fluchtpunkt gibt: „Ich ordne alle Elemente im sich wiederholenden Wechselspiel rhythmisch so an, dass die Raumverortung immer ambivalent bleibt. Vieles befindet sich gleichzeitig auf allen drei Ebenen: Vorne, Hinten und in der Mitte.
“ So erscheinen viele Formen als Teil eines größeren Ganzen, das sich wiederum in immer detailliertere Symbole und Szenen zu unterteilen scheint. Das lässt sich auch bei Sadowiczʼ kleinformatigen Werken für den Kunstautomaten beobachten.
Mein interessanter Besuch in Georg Sadowiczʼ Atelier dauert in meinen Gedanken fort – nicht zuletzt, weil er mir einen Einblick in die prekäre Situation vieler Berliner Künstlerinnen und Künstler gegeben hat: Sadowicz erzählte mir von seinem früheren Atelier in Berlin Kreuzberg, das mit der Zeit zu teuer wurde. Sein Umzug in die alte Fabrikhalle in Hohenschönhausen ist also auch ein Sinnbild für die räumliche Verdrängung der Berliner Künstlerinnen und Künstler aus dem Zentrum der Stadt an die Peripherie.
Kilian Gärtner, Jewish Places

Hadas Tapouchi (*1981, Mosav Beit Nehemia, Israel), Daniel, Fotografie aus der Serie Dritte Generation, 2013, gestempelt; Jüdisches Museum Berlin.
Kunst gegen das Vergessen
Geschichte lässt sich nicht bannen. Nicht in Messing, nicht in Metall. Sagt zumindest Hadas Tapouchi. Die in Berlin lebende israelische Künstlerin sieht in Monumenten und Inschriften den eigentlichen Sinn des Gedenkens verfehlt. Diese Form der Erinnerung sei unvermeidlich auch eine Flucht ins Vergessen.
Keine Frage: Hadas arbeitet gegen das Vergessen. Als ich sie 2011 erstmals in ihrer damaligen Tel Aviver Wohnung traf, sprang mir als Erstes ein inszeniertes Selbstporträt der Künstlerin in Häftlingskleidung ins Auge: ein früher Vorläufer ihres Projektes Die Dritte Generation. Seitdem sind zahlreiche Porträts entstanden. Bilder gemeinsamer Freunde, ein Bild des Autors selbst, Bilder junger Frauen und Männer aus Berlin, Tel Aviv und Ramallah.
Wie wir zurückblicken
Hadas‘ Anspruch der Erinnerung gegenüber ist bis heute spürbar. In ihrem jüngsten Werk Transforming thematisiert sie die NS-Zwangsarbeit im Raum Berlin und Umgebung. Wie auf der projektbegleitenden Website deutlich wird, entlarvt sie damit eine beinahe unheimliche Spannung zwischen An- und Abwesenheit von Geschichte. Mit Gunter Demnigs bekannten Stolpersteinen will sie diese Arbeit jedoch nicht verglichen wissen. „Es geht hier doch nicht um einzelne Steine!“
, antwortete sie mir darauf kürzlich in einer gemeinsamen Veranstaltung (in der Berliner Galerie Werkraum Bild & Sinn) in aufbrausendem Englisch, die Arme in die Luft reißend. Worum es ihr wirklich geht, darin liegt wohl der Kern ihres Schaffens: Hadas will nichts weniger als die Art und Weise verändern, wie wir heute und zukünftig auf Geschichte blicken.
In Die Dritte Generation legte sie das Fundament für diesen Ansatz. Statt starrem Gedenken stellt sie Gesichter in den Vordergrund. „Die beiden Arbeiten ergänzen sich gegenseitig“
, erklärte Hadas noch am selben Abend. Es sei wichtig, sie nicht getrennt zu betrachten. Doch Die Dritte Generation, eine Porträtserie jüdischer und arabischer Israelis und junger Deutscher, ist noch lange nicht abgeschlossen. Tapouchi sieht sie als „work in progress“.
Den Ausgangspunkt der beiden Projekte bildete Hadas‘ eigene Biografie. Ihre Großmutter, eine polnische Shoah-Überlebende, berichtete kaum von der Kriegszeit. Auf die Mutter der Künstlerin legte sich der Schatten jener Erfahrung wie ein bleierner Teppich. Ihre eigene Rolle als Vertreterin der dritten Generation von Opfern der Shoah wurde der Künstlerin früh bewusst.
Die Anziehungskraft der dritten Generation
Der Gedanke, dass es auch in Deutschland eine dritte Generation geben könnte, Menschen ihres Alters, die auf vergleichbare Weise vom Schweigen über die Vergangenheit betroffen sind, kam ihr erst später. Vor knapp sechs Jahren begann sie, Menschen in Berlin zu porträtieren. „Ich war neugierig, ob Leute dort sich überhaupt als dritte Generation verstehen
“, erinnert sie sich. Bis heute hat sie darauf keine eindeutige Antwort. Die Anziehungskraft zwischen Deutschen und Israelis sei aber auch ein Indiz für die Verbindung der beiden Generationen, die man, so Hadas weiter, auch auf jüngere Palästinenser*innen bzw. arabische Israelis ausweiten müsse.
Die abgebildeten Personen erscheinen dem Betrachter merkwürdig vertraut. Es ist jene durch die Bilder vermittelte familiäre Nähe, die es erlaubt, eigentlich konträre Geschichten zu einer fotografischen Collage zu fusionieren. Das verbindende Element zwischen den Personen in Hadas‘ Bilderserie ist der Faktor Sexualität, als queere Sexualität, jenseits der (Hetero-)Norm liegend. Tatsächlich identifizieren sich damit fast alle abgebildeten Personen. „Die Community die ich in
Die Dritte Generation
kreiere, ist auf zentrale Weise von der queer-community beeinflusst.“
Verbindungen statt Gegensätze
Der historische Hintergrund ihres Projekts – die Shoah, beleuchtet aus der Perspektive der Nachkommen von Opfern und Tätern, ebenso wie die Nakba (das arabische Wort für „Katastrophe“, das sich auf die Vertreibungen von Palästinensern während des israelischen Unabhängigkeitskrieges bezieht) – wird durch persönliche Geschichten ergänzt und unterläuft so starre Narrative. “Die veränderte Auflösung der Kamera erlaubt es mir, die Verbindungen zwischen den Personen zu beleuchten statt ihre Gegensätze
“, erklärt Tapouchi.
Zweifellos ist das ein streitbares Vorgehen. Wollte man den Status quo heutiger israelischer Gedenkpolitik in zwei Wörtern beschreiben, dann lauteten diese: „Al Tisch’we! (Vergleiche nicht!)“. Damit ist gemeint, dass die Shoah nicht mit anderen historischen Ereignissen verglichen werden soll. „Diese Kritik höre ich dauernd
“, beklagt Tapouchi, „dabei ging es mir nie um einen Vergleich!“
Ihr Ziel sei es hingegen gewesen zu zeigen, was Israelis, Deutsche und Palästinenser in der dritten Generation gemeinsam haben. Dieser Gedanke aber wirke in Israel bereits radikal. Hier diene, berichtet Hadas nicht ohne einen Funken von Resignation, Erinnerung leider in erster Linie dem Nationalbewusstsein. Der Großteil der Leute denke einfach nicht nach.
Welche Form der Erinnerung ist erlaubt?
Eine Feststellung, die sich in gewissem Maß wohl auch auf Deutschland übertragen ließe. Sicher ist: Die Dritte Generation trifft auf hochsensible Fragen: Was heißt Erinnerung knapp siebzig Jahre nach der Shoah? Beinahe siebzig Jahre nach Gründung des Staates Israels und der BRD? Wer erinnert, und aus welcher Motivation heraus? Wie verändert sich Erinnerung über die Zeit? Welche Form der Erinnerung ist erlaubt? Und welche verboten?
Heute ist Hadas gespannt, wie sich Die Dritte Generation entwickeln wird. Manchmal fragt sie sich, ob ihr Projekt in zehn, zwanzig Jahren vielleicht lächerlich erscheint, als Klischee. Oder ob es im Gegenteil wegweisend sein könnte für eine neue Form des Gedenkens. Wie die vierte Generation nach der Shoah darauf reagieren wird. Oder die fünfte. Eines aber ist sicher: Staub ansetzen wird die Serie so schnell keinen.
Hanno Hauenstein, Wechselausstellungen

Hadas Tapouchi (*1981, Mosav Beit Nehemia, Israel), Tomer und Haled, Foto aus der Serie Die Dritte Generation, 2013, Jüdisches Museum Berlin.
Kunst gegen das Vergessen
Geschichte lässt sich nicht bannen. Nicht in Messing, nicht in Metall. Sagt zumindest Hadas Tapouchi. Die in Berlin lebende israelische Künstlerin sieht in Monumenten und Inschriften den eigentlichen Sinn des Gedenkens verfehlt. Diese Form der Erinnerung sei unvermeidlich auch eine Flucht ins Vergessen.
Keine Frage: Hadas arbeitet gegen das Vergessen. Als ich sie 2011 erstmals in ihrer damaligen Tel Aviver Wohnung traf, sprang mir als Erstes ein inszeniertes Selbstporträt der Künstlerin in Häftlingskleidung ins Auge: ein früher Vorläufer ihres Projektes Die Dritte Generation. Seitdem sind zahlreiche Porträts entstanden. Bilder gemeinsamer Freunde, ein Bild des Autors selbst, Bilder junger Frauen und Männer aus Berlin, Tel Aviv und Ramallah.
Wie wir zurückblicken
Hadas‘ Anspruch der Erinnerung gegenüber ist bis heute spürbar. In ihrem jüngsten Werk Transforming thematisiert sie die NS-Zwangsarbeit im Raum Berlin und Umgebung. Wie auf der projektbegleitenden Website deutlich wird, entlarvt sie damit eine beinahe unheimliche Spannung zwischen An- und Abwesenheit von Geschichte. Mit Gunter Demnigs bekannten Stolpersteinen will sie diese Arbeit jedoch nicht verglichen wissen. „Es geht hier doch nicht um einzelne Steine!“
, antwortete sie mir darauf kürzlich in einer gemeinsamen Veranstaltung (in der Berliner Galerie Werkraum Bild & Sinn) in aufbrausendem Englisch, die Arme in die Luft reißend. Worum es ihr wirklich geht, darin liegt wohl der Kern ihres Schaffens: Hadas will nichts weniger als die Art und Weise verändern, wie wir heute und zukünftig auf Geschichte blicken.
In Die Dritte Generation legte sie das Fundament für diesen Ansatz. Statt starrem Gedenken stellt sie Gesichter in den Vordergrund. „Die beiden Arbeiten ergänzen sich gegenseitig“
, erklärte Hadas noch am selben Abend. Es sei wichtig, sie nicht getrennt zu betrachten. Doch Die Dritte Generation, eine Porträtserie jüdischer und arabischer Israelis und junger Deutscher, ist noch lange nicht abgeschlossen. Tapouchi sieht sie als „work in progress“.
Den Ausgangspunkt der beiden Projekte bildete Hadas‘ eigene Biografie. Ihre Großmutter, eine polnische Shoah-Überlebende, berichtete kaum von der Kriegszeit. Auf die Mutter der Künstlerin legte sich der Schatten jener Erfahrung wie ein bleierner Teppich. Ihre eigene Rolle als Vertreterin der dritten Generation von Opfern der Shoah wurde der Künstlerin früh bewusst.
Die Anziehungskraft der dritten Generation
Der Gedanke, dass es auch in Deutschland eine dritte Generation geben könnte, Menschen ihres Alters, die auf vergleichbare Weise vom Schweigen über die Vergangenheit betroffen sind, kam ihr erst später. Vor knapp sechs Jahren begann sie, Menschen in Berlin zu porträtieren. „Ich war neugierig, ob Leute dort sich überhaupt als dritte Generation verstehen
“, erinnert sie sich. Bis heute hat sie darauf keine eindeutige Antwort. Die Anziehungskraft zwischen Deutschen und Israelis sei aber auch ein Indiz für die Verbindung der beiden Generationen, die man, so Hadas weiter, auch auf jüngere Palästinenser*innen bzw. arabische Israelis ausweiten müsse.
Die abgebildeten Personen erscheinen dem Betrachter merkwürdig vertraut. Es ist jene durch die Bilder vermittelte familiäre Nähe, die es erlaubt, eigentlich konträre Geschichten zu einer fotografischen Collage zu fusionieren. Das verbindende Element zwischen den Personen in Hadas‘ Bilderserie ist der Faktor Sexualität, als queere Sexualität, jenseits der (Hetero-)Norm liegend. Tatsächlich identifizieren sich damit fast alle abgebildeten Personen. „Die Community die ich in
Die Dritte Generation
kreiere, ist auf zentrale Weise von der queer-community beeinflusst.“
Verbindungen statt Gegensätze
Der historische Hintergrund ihres Projekts – die Shoah, beleuchtet aus der Perspektive der Nachkommen von Opfern und Tätern, ebenso wie die Nakba (das arabische Wort für „Katastrophe“, das sich auf die Vertreibungen von Palästinensern während des israelischen Unabhängigkeitskrieges bezieht) – wird durch persönliche Geschichten ergänzt und unterläuft so starre Narrative. “Die veränderte Auflösung der Kamera erlaubt es mir, die Verbindungen zwischen den Personen zu beleuchten statt ihre Gegensätze
“, erklärt Tapouchi.
Zweifellos ist das ein streitbares Vorgehen. Wollte man den Status quo heutiger israelischer Gedenkpolitik in zwei Wörtern beschreiben, dann lauteten diese: „Al Tisch’we! (Vergleiche nicht!)“. Damit ist gemeint, dass die Shoah nicht mit anderen historischen Ereignissen verglichen werden soll. „Diese Kritik höre ich dauernd
“, beklagt Tapouchi, „dabei ging es mir nie um einen Vergleich!“
Ihr Ziel sei es hingegen gewesen zu zeigen, was Israelis, Deutsche und Palästinenser in der dritten Generation gemeinsam haben. Dieser Gedanke aber wirke in Israel bereits radikal. Hier diene, berichtet Hadas nicht ohne einen Funken von Resignation, Erinnerung leider in erster Linie dem Nationalbewusstsein. Der Großteil der Leute denke einfach nicht nach.
Welche Form der Erinnerung ist erlaubt?
Eine Feststellung, die sich in gewissem Maß wohl auch auf Deutschland übertragen ließe. Sicher ist: Die Dritte Generation trifft auf hochsensible Fragen: Was heißt Erinnerung knapp siebzig Jahre nach der Shoah? Beinahe siebzig Jahre nach Gründung des Staates Israels und der BRD? Wer erinnert, und aus welcher Motivation heraus? Wie verändert sich Erinnerung über die Zeit? Welche Form der Erinnerung ist erlaubt? Und welche verboten?
Heute ist Hadas gespannt, wie sich Die Dritte Generation entwickeln wird. Manchmal fragt sie sich, ob ihr Projekt in zehn, zwanzig Jahren vielleicht lächerlich erscheint, als Klischee. Oder ob es im Gegenteil wegweisend sein könnte für eine neue Form des Gedenkens. Wie die vierte Generation nach der Shoah darauf reagieren wird. Oder die fünfte. Eines aber ist sicher: Staub ansetzen wird die Serie so schnell keinen.
Hanno Hauenstein, Wechselausstellungen
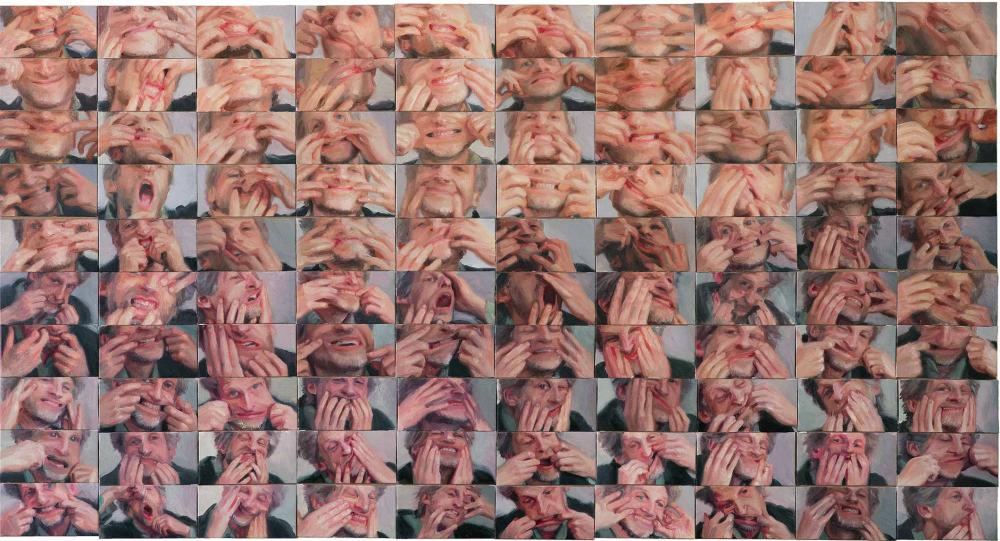
Daniel Wiesenfeld, SMILE, 2014 Foto: Detlef Baltrock
Die „gläsernen Interieurs“ von Daniel Wiesenfeld
Während im Juli und August 2015 überall Menschen in der Sommersonne brutzelten, „backte“ Daniel Wiesenfeld 100 neue Kunstwerke für unseren Kunstautomaten. Welch ein Glück, denn der Automat war zu diesem Zeitpunkt fast leergekauft!
Es war schon die dritte Reihe von Werken, die Daniel dem Jüdischen Museum Berlin überreichte, und keine Serie gleicht der anderen. Im April 2015 erhielten wir 100 Ölbilder, in denen sich der Künstler Grimassen schneidend selbst porträtierte, sowie 100 Kohlezeichnungen mit unterschiedlichsten Motiven. Bei seiner neuen Serie entschied sich Daniel für eine Technik, die sowohl für ihn selbst neu war als auch im Kunstautomaten eine Premiere feierte: die Glasmalerei.
Glasarbeiten in Tempelhof
Für dieses Interview besuche ich Daniel in Tempelhof. Hier, in der Werkstatt eines Bekannten, hat er die Möglichkeit, einen elektrischen Brennofen zu nutzen, der für die Produktion seiner Glasarbeiten unentbehrlich ist. Bis auf 650°C muss man das Glas stufenweise erhitzen, um die Farbe einzubrennen, dies hat er mir schon im Vorfeld verraten. Es ist ein drückend warmer Vormittag, und ich bin erleichtert, als mir Daniel erklärt, dass er den Ofen nur über Nacht laufen lässt. Gerade ist der nächtliche Brennvorgang beendet und die warmen, „frisch gebackenen“ Glasplatten liegen zum Abkühlen noch im Ofen. Weitere kleinformatige Glasscheiben liegen verteilt auf einem Tisch. Sie zeigen Einblicke in dunkle Innenräume: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer. Auf einigen sind nur einzelne Einrichtungsgegenstände zu sehen: ein alter Schaukelstuhl, ein Beistelltisch mit Blumenvase oder ein prächtiges Himmelbett. Menschen sind nicht zu erkennen. A bed, a chair, a table heißt diese Serie handgefertigter Unikate.
Licht und Schwarzlotmalerei
Auf dem Tisch steht ein verschlossenes Glas mit schwarzem Pulver. Das Etikett zeigt einen Totenkopf und andere Warnsymbole. Daniel Wiesenfelds Glasarbeiten sind aus herkömmlichem Fensterglas gefertigt, das er mit Schwarzlot bemalt hat. Schwarzlot ist ein Farbpulver, das in seiner ursprünglichen Form aus Bleioxid besteht und schon im Mittelalter zur Glasmalerei verwendet wurde, heute jedoch wenig gebräuchlich ist. Daniel musste lange suchen, bis er schließlich eine bleifreie Version fand.
Die ästhetische Wirkung der Schwarzlotmalerei kommt erst bei Lichteinfall zum Vorschein. Die gläsernen Innenräume wirken auf mich wie Bilder aus vergangenen Zeiten – wie alte, schon leicht verblasste Schwarzweißfotografien.
Diese Assoziation ist gewollt. Bewusst orientiert sich Daniel bei der Auswahl seiner Motive an historischen Raumansichten, etwa aus der Zeit der Belle Epoque. Doch nicht nur die Motive stammen aus der Vergangenheit, auch die Bilder unterliegen einem künstlichen „Verwitterungsprozess“. Mit verschiedenen Techniken erzeugt Daniel den Effekt, dass die Räume geheimnisvoll, fast geisterhaft wirken – wie hinter einem zarten Schleier.
Menschliche Präsenz im „gläsernen Interieur“
Im Gespräch führt er aus, dass es ihm besonders wichtig sei, bewohnte Räume zu erschaffen, ohne konkrete Personen zu zeigen. „Die Menschen sind nicht mehr da, aber diese Räume aus unterschiedlichen Vergangenheiten lassen sie noch erahnen. Die Präsenz der Menschen hallt in ihnen nach wie ein Echo.
“ Die menschliche Präsenz im gemalten Bild ist ein zentrales Thema in den Arbeiten von Daniel Wiesenfeld. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er vor allem als Porträtmaler bekannt wurde. Viele seiner Porträts sind als Auftragsarbeiten entstanden. Daniel erzählt: „Porträts haben mich schon als Kind fasziniert – Bilder, die den eigenen Blick erwiderten und mehr lebendiges Gegenüber als Abbild zu sein schienen. Mir ist bei meinen eigenen Porträts wichtig, über die oberflächliche Wiedergabe bloßer Ähnlichkeit hinaus einen tieferen Einblick in das Wesen der gemalten Personen zu ermöglichen.
“
Hintergrund des Künstlers
Daniel ist in den USA geboren und in Bayern aufgewachsen. Er studierte Kunst, mit Schwerpunkt Malerei, an der Akademie der Bildenden Künste in München und am Queens College in New York. Seit 2000 lebt er mit seiner Familie in Berlin und stand in den letzten Wochen in engem Kontakt mit den Kuratorinnen der Dauerausstellung, in welcher der Kunstautomat zu finden ist. „Solche Projekte wie der Kunstautomat bringen einen dazu, sich intensiver mit den Arbeiten auseinanderzusetzen“
, meint Daniel. Und so führt ein Projekt zum anderen. Aus den ersten Glasplatten der Serie A bed, a chair, a table schuf Daniel eine gleichnamige Installation, die Teil der Ausstellung Black & White im HilbertRaum wurde. Die „gläsernen Interieurs“ waren an Nylonfäden an einem Tisch befestigt, der kopfüber von der Raumdecke hing. Wie ein gläsernes Windspiel, bei dem sich je nach Lichteinfall ein anderer Raum dem Betrachter eröffnete.
Bevor ich mich verabschiede und in die glühende Mittagssonne hinaustrete, schildert Daniel mir noch sein neuestes Projekt: eine Verbindung aus Öl- und Glasmalerei. Räumlichkeit, Perspektive und Lichteffekte sind nur einige Stichpunkte, die er nennt. Es hört sich sehr spannend an. „Ich habe noch viele Ideen im Kopf
“, sagt er. „Ich glaube, dass darin noch viel Potential steckt.
“
Anna Golus, Sammlungsmanagement
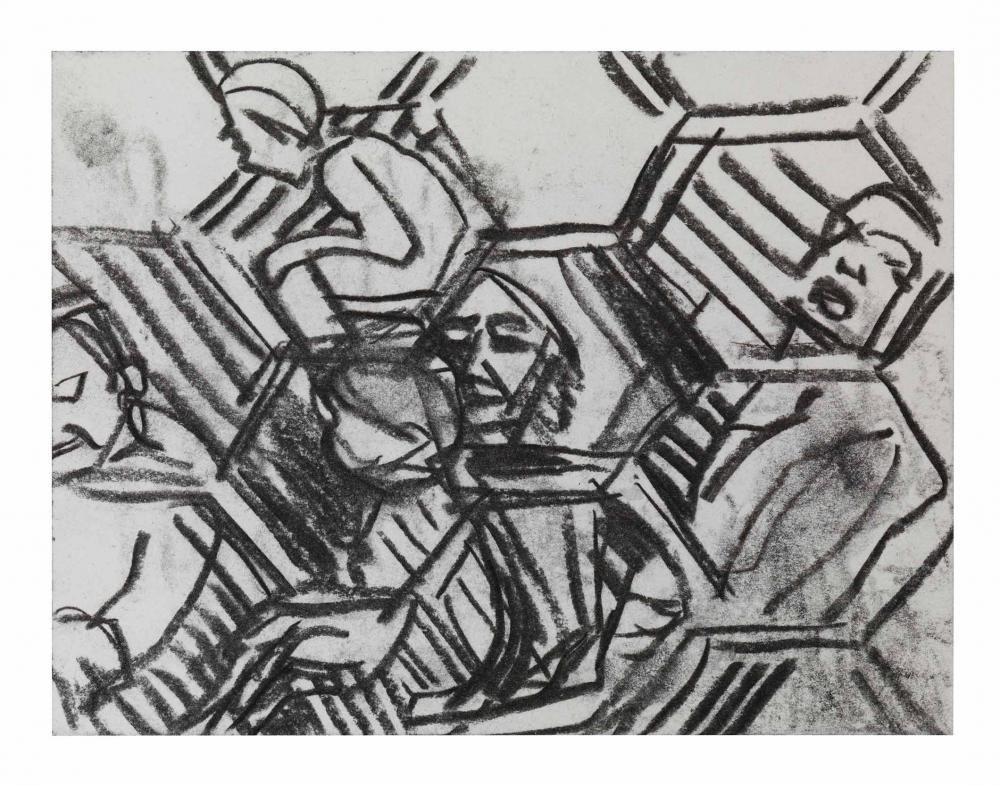
Daniel Wiesenfeld, Kohle-Zeichnungen, beidseitige Zeichnung mit Kohle auf den Seiten kleiner Skizzenbücher, 2014 Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe
Die „gläsernen Interieurs“ von Daniel Wiesenfeld
Während im Juli und August 2015 überall Menschen in der Sommersonne brutzelten, „backte“ Daniel Wiesenfeld 100 neue Kunstwerke für unseren Kunstautomaten. Welch ein Glück, denn der Automat war zu diesem Zeitpunkt fast leergekauft!
Es war schon die dritte Reihe von Werken, die Daniel dem Jüdischen Museum Berlin überreichte, und keine Serie gleicht der anderen. Im April 2015 erhielten wir 100 Ölbilder, in denen sich der Künstler Grimassen schneidend selbst porträtierte, sowie 100 Kohlezeichnungen mit unterschiedlichsten Motiven. Bei seiner neuen Serie entschied sich Daniel für eine Technik, die sowohl für ihn selbst neu war als auch im Kunstautomaten eine Premiere feierte: die Glasmalerei.
Glasarbeiten in Tempelhof
Für dieses Interview besuche ich Daniel in Tempelhof. Hier, in der Werkstatt eines Bekannten, hat er die Möglichkeit, einen elektrischen Brennofen zu nutzen, der für die Produktion seiner Glasarbeiten unentbehrlich ist. Bis auf 650°C muss man das Glas stufenweise erhitzen, um die Farbe einzubrennen, dies hat er mir schon im Vorfeld verraten. Es ist ein drückend warmer Vormittag, und ich bin erleichtert, als mir Daniel erklärt, dass er den Ofen nur über Nacht laufen lässt. Gerade ist der nächtliche Brennvorgang beendet und die warmen, „frisch gebackenen“ Glasplatten liegen zum Abkühlen noch im Ofen. Weitere kleinformatige Glasscheiben liegen verteilt auf einem Tisch. Sie zeigen Einblicke in dunkle Innenräume: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer. Auf einigen sind nur einzelne Einrichtungsgegenstände zu sehen: ein alter Schaukelstuhl, ein Beistelltisch mit Blumenvase oder ein prächtiges Himmelbett. Menschen sind nicht zu erkennen. A bed, a chair, a table heißt diese Serie handgefertigter Unikate.
Licht und Schwarzlotmalerei
Auf dem Tisch steht ein verschlossenes Glas mit schwarzem Pulver. Das Etikett zeigt einen Totenkopf und andere Warnsymbole. Daniel Wiesenfelds Glasarbeiten sind aus herkömmlichem Fensterglas gefertigt, das er mit Schwarzlot bemalt hat. Schwarzlot ist ein Farbpulver, das in seiner ursprünglichen Form aus Bleioxid besteht und schon im Mittelalter zur Glasmalerei verwendet wurde, heute jedoch wenig gebräuchlich ist. Daniel musste lange suchen, bis er schließlich eine bleifreie Version fand.
Die ästhetische Wirkung der Schwarzlotmalerei kommt erst bei Lichteinfall zum Vorschein. Die gläsernen Innenräume wirken auf mich wie Bilder aus vergangenen Zeiten – wie alte, schon leicht verblasste Schwarzweißfotografien.
Diese Assoziation ist gewollt. Bewusst orientiert sich Daniel bei der Auswahl seiner Motive an historischen Raumansichten, etwa aus der Zeit der Belle Epoque. Doch nicht nur die Motive stammen aus der Vergangenheit, auch die Bilder unterliegen einem künstlichen „Verwitterungsprozess“. Mit verschiedenen Techniken erzeugt Daniel den Effekt, dass die Räume geheimnisvoll, fast geisterhaft wirken – wie hinter einem zarten Schleier.
Menschliche Präsenz im „gläsernen Interieur“
Im Gespräch führt er aus, dass es ihm besonders wichtig sei, bewohnte Räume zu erschaffen, ohne konkrete Personen zu zeigen. „Die Menschen sind nicht mehr da, aber diese Räume aus unterschiedlichen Vergangenheiten lassen sie noch erahnen. Die Präsenz der Menschen hallt in ihnen nach wie ein Echo.
“ Die menschliche Präsenz im gemalten Bild ist ein zentrales Thema in den Arbeiten von Daniel Wiesenfeld. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er vor allem als Porträtmaler bekannt wurde. Viele seiner Porträts sind als Auftragsarbeiten entstanden. Daniel erzählt: „Porträts haben mich schon als Kind fasziniert – Bilder, die den eigenen Blick erwiderten und mehr lebendiges Gegenüber als Abbild zu sein schienen. Mir ist bei meinen eigenen Porträts wichtig, über die oberflächliche Wiedergabe bloßer Ähnlichkeit hinaus einen tieferen Einblick in das Wesen der gemalten Personen zu ermöglichen.
“
Hintergrund des Künstlers
Daniel ist in den USA geboren und in Bayern aufgewachsen. Er studierte Kunst, mit Schwerpunkt Malerei, an der Akademie der Bildenden Künste in München und am Queens College in New York. Seit 2000 lebt er mit seiner Familie in Berlin und stand in den letzten Wochen in engem Kontakt mit den Kuratorinnen der Dauerausstellung, in welcher der Kunstautomat zu finden ist. „Solche Projekte wie der Kunstautomat bringen einen dazu, sich intensiver mit den Arbeiten auseinanderzusetzen“
, meint Daniel. Und so führt ein Projekt zum anderen. Aus den ersten Glasplatten der Serie A bed, a chair, a table schuf Daniel eine gleichnamige Installation, die Teil der Ausstellung Black & White im HilbertRaum wurde. Die „gläsernen Interieurs“ waren an Nylonfäden an einem Tisch befestigt, der kopfüber von der Raumdecke hing. Wie ein gläsernes Windspiel, bei dem sich je nach Lichteinfall ein anderer Raum dem Betrachter eröffnete.
Bevor ich mich verabschiede und in die glühende Mittagssonne hinaustrete, schildert Daniel mir noch sein neuestes Projekt: eine Verbindung aus Öl- und Glasmalerei. Räumlichkeit, Perspektive und Lichteffekte sind nur einige Stichpunkte, die er nennt. Es hört sich sehr spannend an. „Ich habe noch viele Ideen im Kopf
“, sagt er. „Ich glaube, dass darin noch viel Potential steckt.
“
Anna Golus, Sammlungsmanagement
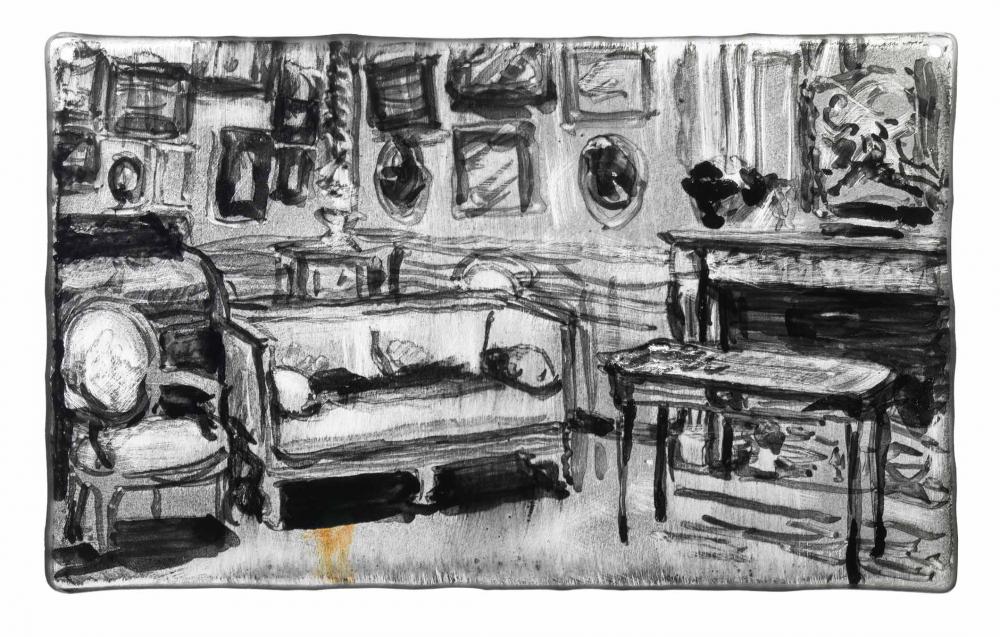
Daniel Wiesenfeld, Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe
Die „gläsernen Interieurs“ von Daniel Wiesenfeld
Während im Juli und August 2015 überall Menschen in der Sommersonne brutzelten, „backte“ Daniel Wiesenfeld 100 neue Kunstwerke für unseren Kunstautomaten. Welch ein Glück, denn der Automat war zu diesem Zeitpunkt fast leergekauft!
Es war schon die dritte Reihe von Werken, die Daniel dem Jüdischen Museum Berlin überreichte, und keine Serie gleicht der anderen. Im April 2015 erhielten wir 100 Ölbilder, in denen sich der Künstler Grimassen schneidend selbst porträtierte, sowie 100 Kohlezeichnungen mit unterschiedlichsten Motiven. Bei seiner neuen Serie entschied sich Daniel für eine Technik, die sowohl für ihn selbst neu war als auch im Kunstautomaten eine Premiere feierte: die Glasmalerei.
Glasarbeiten in Tempelhof
Für dieses Interview besuche ich Daniel in Tempelhof. Hier, in der Werkstatt eines Bekannten, hat er die Möglichkeit, einen elektrischen Brennofen zu nutzen, der für die Produktion seiner Glasarbeiten unentbehrlich ist. Bis auf 650°C muss man das Glas stufenweise erhitzen, um die Farbe einzubrennen, dies hat er mir schon im Vorfeld verraten. Es ist ein drückend warmer Vormittag, und ich bin erleichtert, als mir Daniel erklärt, dass er den Ofen nur über Nacht laufen lässt. Gerade ist der nächtliche Brennvorgang beendet und die warmen, „frisch gebackenen“ Glasplatten liegen zum Abkühlen noch im Ofen. Weitere kleinformatige Glasscheiben liegen verteilt auf einem Tisch. Sie zeigen Einblicke in dunkle Innenräume: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer. Auf einigen sind nur einzelne Einrichtungsgegenstände zu sehen: ein alter Schaukelstuhl, ein Beistelltisch mit Blumenvase oder ein prächtiges Himmelbett. Menschen sind nicht zu erkennen. A bed, a chair, a table heißt diese Serie handgefertigter Unikate.
Licht und Schwarzlotmalerei
Auf dem Tisch steht ein verschlossenes Glas mit schwarzem Pulver. Das Etikett zeigt einen Totenkopf und andere Warnsymbole. Daniel Wiesenfelds Glasarbeiten sind aus herkömmlichem Fensterglas gefertigt, das er mit Schwarzlot bemalt hat. Schwarzlot ist ein Farbpulver, das in seiner ursprünglichen Form aus Bleioxid besteht und schon im Mittelalter zur Glasmalerei verwendet wurde, heute jedoch wenig gebräuchlich ist. Daniel musste lange suchen, bis er schließlich eine bleifreie Version fand.
Die ästhetische Wirkung der Schwarzlotmalerei kommt erst bei Lichteinfall zum Vorschein. Die gläsernen Innenräume wirken auf mich wie Bilder aus vergangenen Zeiten – wie alte, schon leicht verblasste Schwarzweißfotografien.
Diese Assoziation ist gewollt. Bewusst orientiert sich Daniel bei der Auswahl seiner Motive an historischen Raumansichten, etwa aus der Zeit der Belle Epoque. Doch nicht nur die Motive stammen aus der Vergangenheit, auch die Bilder unterliegen einem künstlichen „Verwitterungsprozess“. Mit verschiedenen Techniken erzeugt Daniel den Effekt, dass die Räume geheimnisvoll, fast geisterhaft wirken – wie hinter einem zarten Schleier.
Menschliche Präsenz im „gläsernen Interieur“
Im Gespräch führt er aus, dass es ihm besonders wichtig sei, bewohnte Räume zu erschaffen, ohne konkrete Personen zu zeigen. „Die Menschen sind nicht mehr da, aber diese Räume aus unterschiedlichen Vergangenheiten lassen sie noch erahnen. Die Präsenz der Menschen hallt in ihnen nach wie ein Echo.
“ Die menschliche Präsenz im gemalten Bild ist ein zentrales Thema in den Arbeiten von Daniel Wiesenfeld. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er vor allem als Porträtmaler bekannt wurde. Viele seiner Porträts sind als Auftragsarbeiten entstanden. Daniel erzählt: „Porträts haben mich schon als Kind fasziniert – Bilder, die den eigenen Blick erwiderten und mehr lebendiges Gegenüber als Abbild zu sein schienen. Mir ist bei meinen eigenen Porträts wichtig, über die oberflächliche Wiedergabe bloßer Ähnlichkeit hinaus einen tieferen Einblick in das Wesen der gemalten Personen zu ermöglichen.
“
Hintergrund des Künstlers
Daniel ist in den USA geboren und in Bayern aufgewachsen. Er studierte Kunst, mit Schwerpunkt Malerei, an der Akademie der Bildenden Künste in München und am Queens College in New York. Seit 2000 lebt er mit seiner Familie in Berlin und stand in den letzten Wochen in engem Kontakt mit den Kuratorinnen der Dauerausstellung, in welcher der Kunstautomat zu finden ist. „Solche Projekte wie der Kunstautomat bringen einen dazu, sich intensiver mit den Arbeiten auseinanderzusetzen“
, meint Daniel. Und so führt ein Projekt zum anderen. Aus den ersten Glasplatten der Serie A bed, a chair, a table schuf Daniel eine gleichnamige Installation, die Teil der Ausstellung Black & White im HilbertRaum wurde. Die „gläsernen Interieurs“ waren an Nylonfäden an einem Tisch befestigt, der kopfüber von der Raumdecke hing. Wie ein gläsernes Windspiel, bei dem sich je nach Lichteinfall ein anderer Raum dem Betrachter eröffnete.
Bevor ich mich verabschiede und in die glühende Mittagssonne hinaustrete, schildert Daniel mir noch sein neuestes Projekt: eine Verbindung aus Öl- und Glasmalerei. Räumlichkeit, Perspektive und Lichteffekte sind nur einige Stichpunkte, die er nennt. Es hört sich sehr spannend an. „Ich habe noch viele Ideen im Kopf
“, sagt er. „Ich glaube, dass darin noch viel Potential steckt.
“
Anna Golus, Sammlungsmanagement
August–Oktober 2014

Ruthe Zuntz (*1971, Haifa, Israel), 9 m aus der Serie PHOTOMAT: Challenging WallMAT, Israel/Berlin, Fotoabzug auf Aluminium-Dibond, 2013-2014; Jüdisches Museum Berlin.
Fotos, die Masken herunterreißen – Ein Gespräch mit Ruthe Zuntz
Dezember 2014, nicht einmal drei Monate, nachdem der Kunstautomat in die zweite Runde gegangen ist, sind die 1.400 Objekte auch schon ausverkauft. Mit etwas Glück konnten die Besucherinnen und Besucher etwa ein Bild von Ruthe Zuntz aus dem Automaten ziehen: PHOTOMAT: Challenging WallMAT nannte die Fotografin ihre zehn Motive umfassende Reihe auf quadratischen Aluminium-Dibonds, die nun in verschiedenen Haushalten strahlen – so wie Ruthe selbst, die ich vor Kurzem getroffen habe, um mehr über ihre Kunst zu erfahren:
Alice Lanzke: Ruthe, Du bist eigentlich für große, raumgreifende Installationen bekannt. Für den Kunstautomaten hast Du eine Reihe kleiner Fotoabzüge erstellt. Wie passt das zusammen?
Ruthe Zuntz: Ich fand das Projekt wirklich spannend, weil es zu einem meiner Grundgedanken passt: Kunst kann so viel bewegen und helfen, Dinge zu ändern. Durch den Kunstautomaten haben die Menschen nun die Gelegenheit, ein Fragment meiner Arbeit mit nach Hause zu nehmen, ein Stück „Take-Away-Art“.
Alice Lanzke: Die Bilder Deiner Reihe PHOTOMAT: Challenging WallMAT für den Kunstautomaten stammen aus Deinem Projekt Challenging Walls, bei dem Du 2007 auf ein Stück der Mauer, die Israel vom Westjordanland trennt, Fotos aus Israel, Palästina, Nordirland, Zypern und Deutschland projiziert hast. Vielleicht kannst Du unseren Leserinnen und Lesern etwas über das Projekt erzählen – hier in Deutschland haben wir ja auch unsere Erfahrungen mit Mauern…
Ruthe Zuntz: Ich war kurz vor dem Mauerfall das erste Mal in Berlin, bevor ich 1991 endgültig in die Stadt gezogen bin. Damals dachte ich, die Ära der Mauern sei endgültig vorbei – ich habe mich so gefreut! Und dann wurde 2003 die Mauer in Israel errichtet. Man kann sie als Schutz sehen, man kann sie aber auch anders bewerten: Sie trennt Menschen voneinander, Freund*innen wie Feind*innen. Gemeinsam mit anderen Künstlern haben wir mit der Mauer gespielt, sie wie einen Silver screen benutzt. Hier findet sich dann auch ein Bezug zu meinen Fotos für den Kunstautomaten! Diese sind ja auf Silberplatten gedruckt, Silver screen – silberne Platten. (lacht)
Alice Lanzke: Was wolltest Du mit Challenging Walls erreichen?
Ruthe Zuntz: Mir kam die Idee für das Projekt 2003, als es sehr viele Terroranschläge in meiner Heimat Israel gab. Ich lebte damals schon in Berlin, wurde aber oft von Freund*innen angerufen, die immer verzweifelter klangen. Das konnte ich nicht länger mit ansehen. Also fragte ich mich, was ich als kleine Künstlerin machen kann, um einen Funken von Hoffnung und Frieden zu schaffen. Nach und nach entwickelte ich so Challenging Walls: Mir ging es darum, den Alltag von Menschen zu zeigen, die von Mauern getrennt werden. Künstler*innen aus Israel und Palästina haben ganz alltägliche Fotos diesseits und jenseits der Mauer geschossen – und so ein Fenster geöffnet. Um eine universellere Perspektive zu geben, wurden auch Künstler*innen aus Europa eingeladen – aus Nordirland, Zypern und Deutschland – um ihren Blick auf Mauern und das Leben mit ihnen beizusteuern.
Alice Lanzke: Das Ergebnis war dann eine riesige Multimedia-Inszenierung auf einem Teilabschnitt der Mauer…
Ruthe Zuntz: … als ich diese nach der langen harten Arbeit das erste Mal gesehen habe, war ich sehr berührt. Viele Menschen sagten mir vorher, dass das Projekt scheitern würde, dass ich niemals die notwendigen Genehmigungen bekommen geschweige denn eine*n palästinensische*n Fotograf*in finden würde. Aber es klappte! So ist etwa der palästinensische Fotograf mittlerweile ein guter Freund von mir – er wohnt gegenüber. Wir haben also wirklich Mauern überwunden. (lacht)
Alice Lanzke: Bei den zehn Bildern aus Israel, die Du nun für den Kunstautomaten ausgewählt hast, fällt die Vielfalt Deiner Motive auf: Es gibt Fotos, die sehr melancholisch, fast schon traurig wirken, und dann wieder solche, die einen ganz eigenen Witz versprühen…
Ruthe Zuntz: Das sind die verschiedenen Seiten des Landes. Mit dem melancholischen Bild meinst Du bestimmt das der alten Frau, die in dem Friseursalon sitzt… Diese Frau hat mich sehr berührt – sie sieht aus, als ob sie seit Jahren darauf wartet, dass etwas passiert, aber das tut es nicht.
Alice Lanzke: Was hat es denn mit dem Bild von der im Wind wehenden Wäsche auf sich?
Ruthe Zuntz: Wäsche ist ein großes Thema für mich. Als ich den ersten Sommer in Berlin war, faszinierte mich das Verhalten der Menschen hier: Die Leute legten sich mitten in der Großstadt nackt zum Sonnen in die Parks. Das würden Israelis oder Palästinenser*innen nie tun. Dafür hängen beide Völker ihre Wäsche draußen auf, was auch sehr intim ist.
Alice Lanzke: Wie war es sonst für Dich, als Du nach Berlin gezogen bist?
Ruthe Zuntz: Im Grunde habe ich den Kreis meines Vaters geschlossen – denn väterlicherseits stamme ich aus einer deutschen Familie und das in 16. Generation. Mein Großvater hatte meinen Vater 1939 nach Palästina geschickt, er selbst wollte in Deutschland bleiben. Als mein Vater mich dann in Berlin besuchte, sprach er zum ersten Mal nach Jahrzehnten wieder Deutsch. Er schloss also durch mich seinen Frieden mit Deutschland. Umso schöner finde ich es, dass mit PHOTOMAT: Challenging WallMAT israelische und palästinensische Fragmente nach Berlin kommen, das ist doch der Gedanke einer „united world“…
Alice Lanzke: …der Kunstautomat ist mittlerweile schon ausverkauft…
Ruthe Zuntz: Wirklich? Das finde ich toll! Denn das heißt, dass die Objekte jetzt schon bei den Menschen zu Hause ihre Aura ausstrahlen.
Alice Lanzke, Marketing und Kommunikation
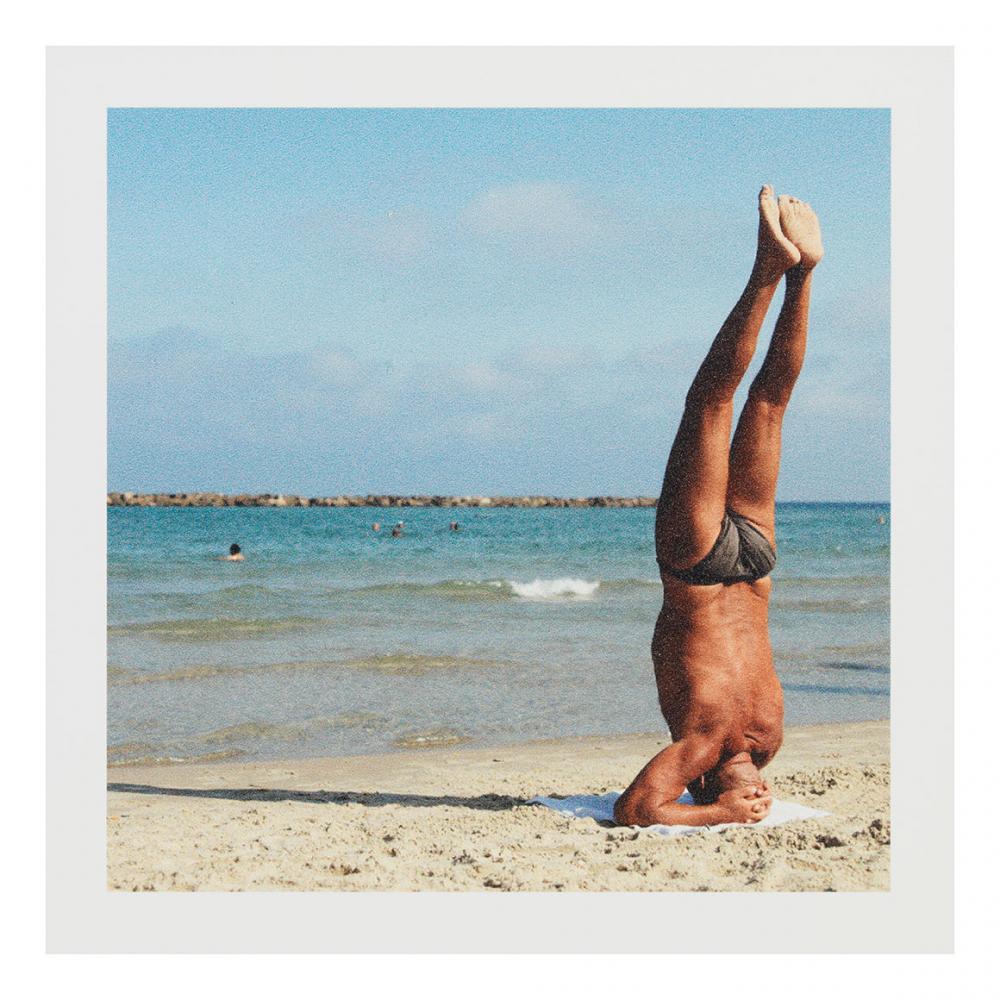
Ruthe Zuntz (*1971, Haifa, Israel), Tel Aviv II aus der Serie PHOTOMAT: Challenging WallMAT, Israel/Berlin, Fotoabzug auf Aluminium-Dibond, 2013-2014; Jüdisches Museum Berlin.
Fotos, die Masken herunterreißen – Ein Gespräch mit Ruthe Zuntz
Dezember 2014, nicht einmal drei Monate, nachdem der Kunstautomat in die zweite Runde gegangen ist, sind die 1.400 Objekte auch schon ausverkauft. Mit etwas Glück konnten die Besucherinnen und Besucher etwa ein Bild von Ruthe Zuntz aus dem Automaten ziehen: PHOTOMAT: Challenging WallMAT nannte die Fotografin ihre zehn Motive umfassende Reihe auf quadratischen Aluminium-Dibonds, die nun in verschiedenen Haushalten strahlen – so wie Ruthe selbst, die ich vor Kurzem getroffen habe, um mehr über ihre Kunst zu erfahren:
Alice Lanzke: Ruthe, Du bist eigentlich für große, raumgreifende Installationen bekannt. Für den Kunstautomaten hast Du eine Reihe kleiner Fotoabzüge erstellt. Wie passt das zusammen?
Ruthe Zuntz: Ich fand das Projekt wirklich spannend, weil es zu einem meiner Grundgedanken passt: Kunst kann so viel bewegen und helfen, Dinge zu ändern. Durch den Kunstautomaten haben die Menschen nun die Gelegenheit, ein Fragment meiner Arbeit mit nach Hause zu nehmen, ein Stück „Take-Away-Art“.
Alice Lanzke: Die Bilder Deiner Reihe PHOTOMAT: Challenging WallMAT für den Kunstautomaten stammen aus Deinem Projekt Challenging Walls, bei dem Du 2007 auf ein Stück der Mauer, die Israel vom Westjordanland trennt, Fotos aus Israel, Palästina, Nordirland, Zypern und Deutschland projiziert hast. Vielleicht kannst Du unseren Leserinnen und Lesern etwas über das Projekt erzählen – hier in Deutschland haben wir ja auch unsere Erfahrungen mit Mauern…
Ruthe Zuntz: Ich war kurz vor dem Mauerfall das erste Mal in Berlin, bevor ich 1991 endgültig in die Stadt gezogen bin. Damals dachte ich, die Ära der Mauern sei endgültig vorbei – ich habe mich so gefreut! Und dann wurde 2003 die Mauer in Israel errichtet. Man kann sie als Schutz sehen, man kann sie aber auch anders bewerten: Sie trennt Menschen voneinander, Freund*innen wie Feind*innen. Gemeinsam mit anderen Künstlern haben wir mit der Mauer gespielt, sie wie einen Silver screen benutzt. Hier findet sich dann auch ein Bezug zu meinen Fotos für den Kunstautomaten! Diese sind ja auf Silberplatten gedruckt, Silver screen – silberne Platten. (lacht)
Alice Lanzke: Was wolltest Du mit Challenging Walls erreichen?
Ruthe Zuntz: Mir kam die Idee für das Projekt 2003, als es sehr viele Terroranschläge in meiner Heimat Israel gab. Ich lebte damals schon in Berlin, wurde aber oft von Freund*innen angerufen, die immer verzweifelter klangen. Das konnte ich nicht länger mit ansehen. Also fragte ich mich, was ich als kleine Künstlerin machen kann, um einen Funken von Hoffnung und Frieden zu schaffen. Nach und nach entwickelte ich so Challenging Walls: Mir ging es darum, den Alltag von Menschen zu zeigen, die von Mauern getrennt werden. Künstler*innen aus Israel und Palästina haben ganz alltägliche Fotos diesseits und jenseits der Mauer geschossen – und so ein Fenster geöffnet. Um eine universellere Perspektive zu geben, wurden auch Künstler*innen aus Europa eingeladen – aus Nordirland, Zypern und Deutschland – um ihren Blick auf Mauern und das Leben mit ihnen beizusteuern.
Alice Lanzke: Das Ergebnis war dann eine riesige Multimedia-Inszenierung auf einem Teilabschnitt der Mauer…
Ruthe Zuntz: … als ich diese nach der langen harten Arbeit das erste Mal gesehen habe, war ich sehr berührt. Viele Menschen sagten mir vorher, dass das Projekt scheitern würde, dass ich niemals die notwendigen Genehmigungen bekommen geschweige denn eine*n palästinensische*n Fotograf*in finden würde. Aber es klappte! So ist etwa der palästinensische Fotograf mittlerweile ein guter Freund von mir – er wohnt gegenüber. Wir haben also wirklich Mauern überwunden. (lacht)
Alice Lanzke: Bei den zehn Bildern aus Israel, die Du nun für den Kunstautomaten ausgewählt hast, fällt die Vielfalt Deiner Motive auf: Es gibt Fotos, die sehr melancholisch, fast schon traurig wirken, und dann wieder solche, die einen ganz eigenen Witz versprühen…
Ruthe Zuntz: Das sind die verschiedenen Seiten des Landes. Mit dem melancholischen Bild meinst Du bestimmt das der alten Frau, die in dem Friseursalon sitzt… Diese Frau hat mich sehr berührt – sie sieht aus, als ob sie seit Jahren darauf wartet, dass etwas passiert, aber das tut es nicht.
Alice Lanzke: Was hat es denn mit dem Bild von der im Wind wehenden Wäsche auf sich?
Ruthe Zuntz: Wäsche ist ein großes Thema für mich. Als ich den ersten Sommer in Berlin war, faszinierte mich das Verhalten der Menschen hier: Die Leute legten sich mitten in der Großstadt nackt zum Sonnen in die Parks. Das würden Israelis oder Palästinenser*innen nie tun. Dafür hängen beide Völker ihre Wäsche draußen auf, was auch sehr intim ist.
Alice Lanzke: Wie war es sonst für Dich, als Du nach Berlin gezogen bist?
Ruthe Zuntz: Im Grunde habe ich den Kreis meines Vaters geschlossen – denn väterlicherseits stamme ich aus einer deutschen Familie und das in 16. Generation. Mein Großvater hatte meinen Vater 1939 nach Palästina geschickt, er selbst wollte in Deutschland bleiben. Als mein Vater mich dann in Berlin besuchte, sprach er zum ersten Mal nach Jahrzehnten wieder Deutsch. Er schloss also durch mich seinen Frieden mit Deutschland. Umso schöner finde ich es, dass mit PHOTOMAT: Challenging WallMAT israelische und palästinensische Fragmente nach Berlin kommen, das ist doch der Gedanke einer „united world“…
Alice Lanzke: …der Kunstautomat ist mittlerweile schon ausverkauft…
Ruthe Zuntz: Wirklich? Das finde ich toll! Denn das heißt, dass die Objekte jetzt schon bei den Menschen zu Hause ihre Aura ausstrahlen.
Alice Lanzke, Marketing und Kommunikation

Daphna Westerman (*1979, Tel Aviv, Israel), Highway, Berlin, 2011, Postkarte des Films In and Between the Cities, 2010-2012; Jüdisches Museum Berlin.
Ein Filmstill im Briefkasten: Daphna Westermans bewegte Postkarten
Haben Sie selbst auch solch eine Postkarte in Ihrem Briefkasten gefunden? Oder sogar das ganze Roadmovie von Daphna Westerman aus unserem Kunstautomaten gezogen? Der Automat ist inzwischen restlos ausverkauft, aber der Film von Daphna läuft noch weiter. Spulen wir einfach ein bisschen zurück… Bevor die Arbeiten der israelischen Künstlerin 2014 in unseren Kunstautomaten gelangten, bekam ich erst einmal Post. Außer meiner Adresse und dem Titel U-Bahn Berlin. From In and between the cities, 2011. A Film by Daphna Westerman stand auf der Karte nichts. Einige Tage später erhielt ich erneut Post. Zeit für ein Telefonat mit Daphna.
Lisa Albrecht: Daphna, warum hast Du Deine Postkarten nicht beschrieben?
Daphna Westerman: Ich habe die Postkarte unbeschrieben gelassen, weil ich finde, das Bild spricht für sich. Es braucht keinen Zusatz. Wenn ich persönliche Worte hinzufüge, sind sie und nicht mehr die Karte selbst das Wichtigste. Ich wollte, dass das Bild im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Ich wollte, dass Leute das Bild betrachten, den Titel lesen und sich dazu eigene Gedanken machen.
Lisa Albrecht: Die Karten zeigen Aufnahmen aus Tel Aviv und Berlin aus den Jahren 2010 und 2011. Was aber hat es mit dem Titel Aus In and between the Cities / Ein Film von Daphna Westerman auf sich?
Daphna Westerman: Als ich dieses Projekt 2010 begann, reiste ich viel durch die Gegend: wegen meiner Arbeit, meiner Eltern und meiner Freund*innen. Hauptsächlich durch Israel, aber auch nach Berlin. Dabei trug ich meine 35mm Kamera immer bei mir und dokumentierte jeden besuchten Ort. Ich fotografierte die Reise und ich fotografierte die Städte, ich fotografierte praktisch immerzu. Anfänglich wollte ich aus diesen Stills einen Film machen. Denn ich liebe Roadmovies. Vor allem die von Wim Wenders, die mich bei diesem Projekt inspiriert haben. Wim Wenders‘ Protagonist*innen reisen von einer Stadt zur anderen, halten alles fest, was sie erleben, sind immer unterwegs.
Lisa Albrecht: Du hast letztlich aber doch keinen Film, sondern eine Fotoserie erschaffen. Wie kam es dazu?
Daphna Westerman: Bei der Durchsicht der Fotos entdeckte ich in den Bildern etwas, das mich plötzlich davon überzeugte, dass sie bereits Teil eines existierenden Films sind. Jedes Foto ist Teil eines großen Ganzen, und wenn du alle Bilder zusammenlegst, dann hast du das Gesamtbild. Für mich ist das nichts anderes, als ein Einzelbild aus einem Film auszuwählen. Und so entschied ich, dass es gar nicht nötig war, aus diesen Fotos einen echten Film zu machen, wenn ich doch einen fiktiven schaffen konnte.
Lisa Albrecht: Und warum hast du Postkarten aus den Fotos gemacht?
Daphna Westerman: Um meinen Weg konzeptionell weiter gehen zu können, musste ich die Fotos verteilen, sie in Postkarten verwandeln und an Menschen verschicken. Dadurch wurde das ganze Projekt zu einem existierenden Film, der die Menschen teilhaben ließ an dem Gefühl, auf Reisen zu sein. Für mich liegt der Bereich Post im öffentlichen Raum und ist doch zugleich etwas sehr Intimes. Mir liegt daran, mit meiner Kunst den direkten Zugang zu Menschen zu finden. Wenn Leute in eine Kunstgalerie gehen, betrachten sie oft Bilder an einer Wand. Das schafft, wie ich finde, eine gewisse Distanz. Man denkt: Jetzt bin ich in einem Museum, jetzt in einer Galerie. Und das ist deutlich weniger persönlich, als wenn du ein Kunstwerk in deinem Briefkasten vorfindest, auf dem auch noch dein Name steht.
Lisa Albrecht: Die Besucher*innen des Jüdischen Museums Berlin konnten nicht nur Deine Postkarten in ihren Briefkästen finden, sondern auch etwas aus dem Kunstautomaten ziehen: Was genau war das?
Daphna Westerman: Sie bekamen ein kleines Heft mit zehn Postkarten von Tel Aviv und Berlin. Das war meine Einladung an sie, Teil meiner Kunst zu werden, sie fortzuführen, sie anzuwenden, damit zu tun, was sie möchten. Es ging mir dabei nicht mehr nur um meine Reise, sondern darum, meinen Weg und den der Museumsbesucher*innen miteinander zu verflechten.
Lisa Albrecht: Was genau sollten unsere Besucher*innen mit den Postkarten tun?
Daphna Westerman: Na, sie natürlich verschicken! Diese Postkarten sind nicht dazu da, sie sich einfach nur an die Wand zu hängen. Man wählt eine aus, adressiert sie, klebt eine Briefmarke drauf und wirft sie in den nächsten Briefkasten. Ich hoffe sehr, dass die Leute meine Kunst an jemanden verschicken, um sie weiterzuführen. Also: Macht was draus!
Lisa Albrecht: Dann könnte man Deine Postkartenserie ja als ein interaktives Roadmovie verstehen. Was machst Du sonst noch für Arbeiten? Und welche Themen sind Dir wichtig?
Daphna Westerman: Mich interessieren besonders urbane Geschichten, das Leben in der Stadt und seine Auswirkung auf uns. In jedem meiner Projekte beschäftige ich mich auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Perspektiven mit diesem Thema. So auch in diesem Kunstautomatenprojekt. Aber dieses Mal geht es nicht nur um das Bereisen von Städten, sondern auch um fehlende Verwurzelung, einen Mangel an Zugehörigkeit und das Gefühl von Bewegung.
Lisa Albrecht: Und woran arbeitest du zurzeit?
Daphna Westerman: Ich arbeite an einem Video, das in meinem Studio in Tel Aviv spielt. Mein Studio ist übrigens in einem Bunker. Ich miete diesen Raum für wenig Geld von der Stadt. Ich habe dort viel Platz und das Gebäude ist mit allerlei Vorrichtungen gegen chemische Waffen und so etwas ausgerüstet. Wahrscheinlich klingt das sonderbar, aber für mich ist das leider Alltag.
Einige Zeit nach unserem Gespräch musste Daphna ihr Studio im Bunker räumen. Sie schrieb mir: „Meine Videoarbeit trägt den Titel
Four hours
und thematisiert die aktuelle Situation. Im Kriegsfall muss ich nämlich diesen Raum, der mir als Künstlerin als Studio dient, innerhalb von vier Stunden vollkommen räumen und verlassen, damit die Leute der Umgebung ihn als Bunker nutzen können. Und genau das ist während meiner Arbeit an dem Projekt geschehen, als wieder Krieg in Gaza ausbrach.“
Anschließend hätte Daphna Westerman wieder in ihr Studio zurückziehen können. Doch im Oktober 2014 ist sie für ein Masterstudium nach Weimar gegangen. Wir wünschen Dir alles Gute, Daphna!
Lisa Albrecht, Marketing und Kommunikation
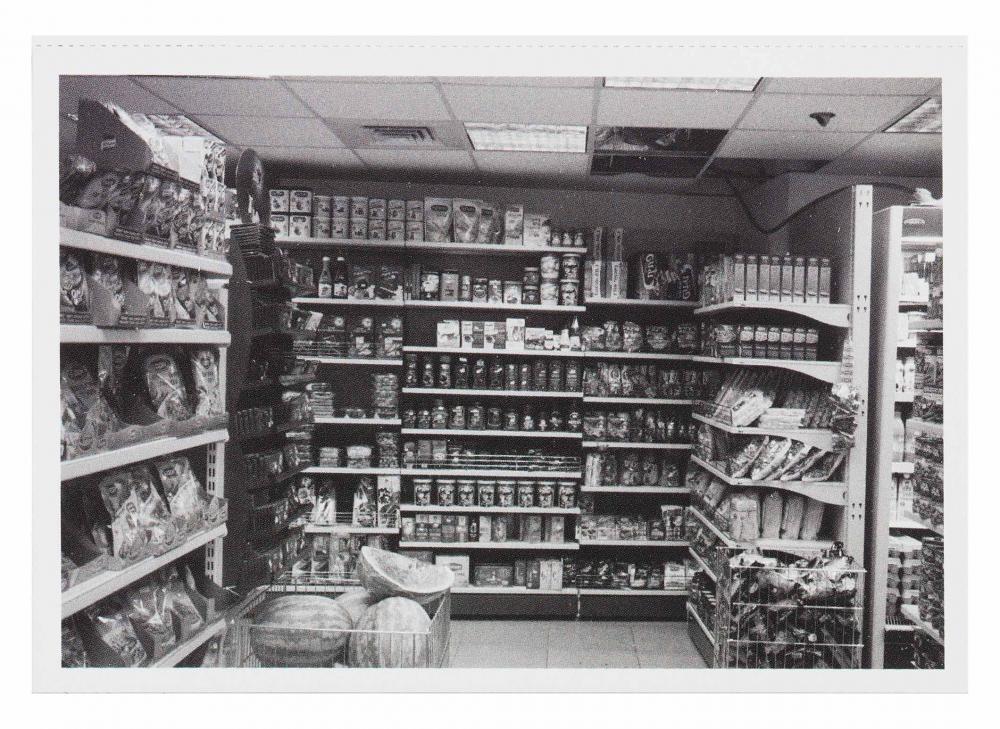
Daphna Westerman (*1979, Tel Aviv, Israel), Supermarket, Frishman St. Tel Aviv, 2010, Postkarte des Films In and Between the Cities, 2010-2012; Jüdisches Museum Berlin.
Ein Filmstill im Briefkasten: Daphna Westermans bewegte Postkarten
Haben Sie selbst auch solch eine Postkarte in Ihrem Briefkasten gefunden? Oder sogar das ganze Roadmovie von Daphna Westerman aus unserem Kunstautomaten gezogen? Der Automat ist inzwischen restlos ausverkauft, aber der Film von Daphna läuft noch weiter. Spulen wir einfach ein bisschen zurück… Bevor die Arbeiten der israelischen Künstlerin 2014 in unseren Kunstautomaten gelangten, bekam ich erst einmal Post. Außer meiner Adresse und dem Titel U-Bahn Berlin. From In and between the cities, 2011. A Film by Daphna Westerman stand auf der Karte nichts. Einige Tage später erhielt ich erneut Post. Zeit für ein Telefonat mit Daphna.
Lisa Albrecht: Daphna, warum hast Du Deine Postkarten nicht beschrieben?
Daphna Westerman: Ich habe die Postkarte unbeschrieben gelassen, weil ich finde, das Bild spricht für sich. Es braucht keinen Zusatz. Wenn ich persönliche Worte hinzufüge, sind sie und nicht mehr die Karte selbst das Wichtigste. Ich wollte, dass das Bild im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Ich wollte, dass Leute das Bild betrachten, den Titel lesen und sich dazu eigene Gedanken machen.
Lisa Albrecht: Die Karten zeigen Aufnahmen aus Tel Aviv und Berlin aus den Jahren 2010 und 2011. Was aber hat es mit dem Titel Aus In and between the Cities / Ein Film von Daphna Westerman auf sich?
Daphna Westerman: Als ich dieses Projekt 2010 begann, reiste ich viel durch die Gegend: wegen meiner Arbeit, meiner Eltern und meiner Freund*innen. Hauptsächlich durch Israel, aber auch nach Berlin. Dabei trug ich meine 35mm Kamera immer bei mir und dokumentierte jeden besuchten Ort. Ich fotografierte die Reise und ich fotografierte die Städte, ich fotografierte praktisch immerzu. Anfänglich wollte ich aus diesen Stills einen Film machen. Denn ich liebe Roadmovies. Vor allem die von Wim Wenders, die mich bei diesem Projekt inspiriert haben. Wim Wenders‘ Protagonist*innen reisen von einer Stadt zur anderen, halten alles fest, was sie erleben, sind immer unterwegs.
Lisa Albrecht: Du hast letztlich aber doch keinen Film, sondern eine Fotoserie erschaffen. Wie kam es dazu?
Daphna Westerman: Bei der Durchsicht der Fotos entdeckte ich in den Bildern etwas, das mich plötzlich davon überzeugte, dass sie bereits Teil eines existierenden Films sind. Jedes Foto ist Teil eines großen Ganzen, und wenn du alle Bilder zusammenlegst, dann hast du das Gesamtbild. Für mich ist das nichts anderes, als ein Einzelbild aus einem Film auszuwählen. Und so entschied ich, dass es gar nicht nötig war, aus diesen Fotos einen echten Film zu machen, wenn ich doch einen fiktiven schaffen konnte.
Lisa Albrecht: Und warum hast du Postkarten aus den Fotos gemacht?
Daphna Westerman: Um meinen Weg konzeptionell weiter gehen zu können, musste ich die Fotos verteilen, sie in Postkarten verwandeln und an Menschen verschicken. Dadurch wurde das ganze Projekt zu einem existierenden Film, der die Menschen teilhaben ließ an dem Gefühl, auf Reisen zu sein. Für mich liegt der Bereich Post im öffentlichen Raum und ist doch zugleich etwas sehr Intimes. Mir liegt daran, mit meiner Kunst den direkten Zugang zu Menschen zu finden. Wenn Leute in eine Kunstgalerie gehen, betrachten sie oft Bilder an einer Wand. Das schafft, wie ich finde, eine gewisse Distanz. Man denkt: Jetzt bin ich in einem Museum, jetzt in einer Galerie. Und das ist deutlich weniger persönlich, als wenn du ein Kunstwerk in deinem Briefkasten vorfindest, auf dem auch noch dein Name steht.
Lisa Albrecht: Die Besucher*innen des Jüdischen Museums Berlin konnten nicht nur Deine Postkarten in ihren Briefkästen finden, sondern auch etwas aus dem Kunstautomaten ziehen: Was genau war das?
Daphna Westerman: Sie bekamen ein kleines Heft mit zehn Postkarten von Tel Aviv und Berlin. Das war meine Einladung an sie, Teil meiner Kunst zu werden, sie fortzuführen, sie anzuwenden, damit zu tun, was sie möchten. Es ging mir dabei nicht mehr nur um meine Reise, sondern darum, meinen Weg und den der Museumsbesucher*innen miteinander zu verflechten.
Lisa Albrecht: Was genau sollten unsere Besucher*innen mit den Postkarten tun?
Daphna Westerman: Na, sie natürlich verschicken! Diese Postkarten sind nicht dazu da, sie sich einfach nur an die Wand zu hängen. Man wählt eine aus, adressiert sie, klebt eine Briefmarke drauf und wirft sie in den nächsten Briefkasten. Ich hoffe sehr, dass die Leute meine Kunst an jemanden verschicken, um sie weiterzuführen. Also: Macht was draus!
Lisa Albrecht: Dann könnte man Deine Postkartenserie ja als ein interaktives Roadmovie verstehen. Was machst Du sonst noch für Arbeiten? Und welche Themen sind Dir wichtig?
Daphna Westerman: Mich interessieren besonders urbane Geschichten, das Leben in der Stadt und seine Auswirkung auf uns. In jedem meiner Projekte beschäftige ich mich auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Perspektiven mit diesem Thema. So auch in diesem Kunstautomatenprojekt. Aber dieses Mal geht es nicht nur um das Bereisen von Städten, sondern auch um fehlende Verwurzelung, einen Mangel an Zugehörigkeit und das Gefühl von Bewegung.
Lisa Albrecht: Und woran arbeitest du zurzeit?
Daphna Westerman: Ich arbeite an einem Video, das in meinem Studio in Tel Aviv spielt. Mein Studio ist übrigens in einem Bunker. Ich miete diesen Raum für wenig Geld von der Stadt. Ich habe dort viel Platz und das Gebäude ist mit allerlei Vorrichtungen gegen chemische Waffen und so etwas ausgerüstet. Wahrscheinlich klingt das sonderbar, aber für mich ist das leider Alltag.
Einige Zeit nach unserem Gespräch musste Daphna ihr Studio im Bunker räumen. Sie schrieb mir: „Meine Videoarbeit trägt den Titel
Four hours
und thematisiert die aktuelle Situation. Im Kriegsfall muss ich nämlich diesen Raum, der mir als Künstlerin als Studio dient, innerhalb von vier Stunden vollkommen räumen und verlassen, damit die Leute der Umgebung ihn als Bunker nutzen können. Und genau das ist während meiner Arbeit an dem Projekt geschehen, als wieder Krieg in Gaza ausbrach.“
Anschließend hätte Daphna Westerman wieder in ihr Studio zurückziehen können. Doch im Oktober 2014 ist sie für ein Masterstudium nach Weimar gegangen. Wir wünschen Dir alles Gute, Daphna!
Lisa Albrecht, Marketing und Kommunikation
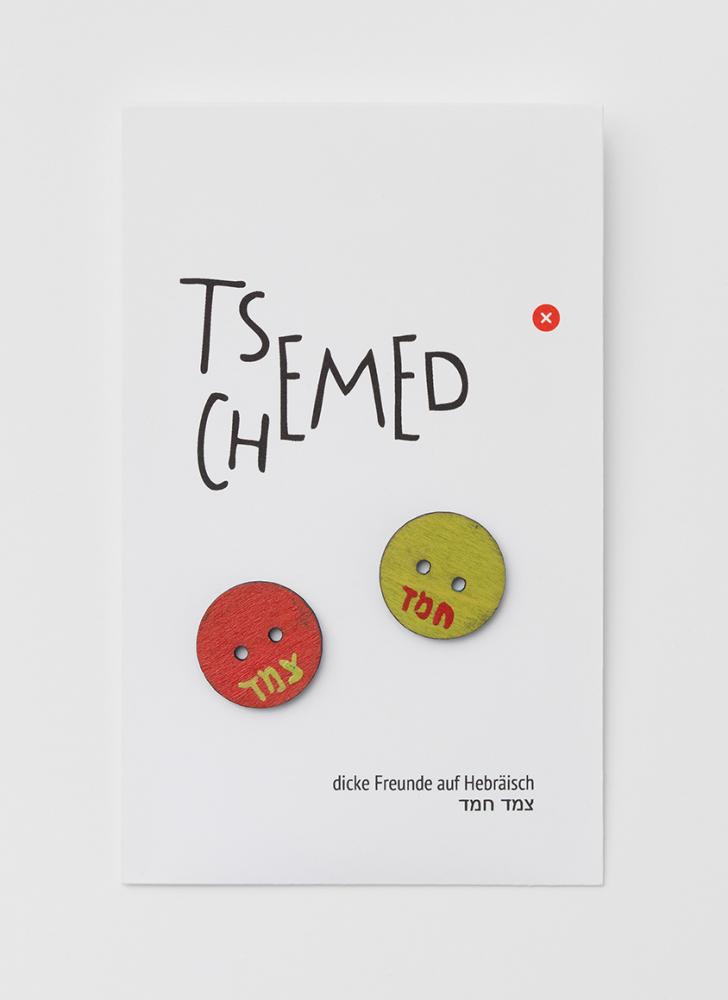
Lina Khesina (*1983, Pensa, Sowjetunion, heute: Russland), Tsemed Chemed – „dicke Freunde“, Zwei bunte Knöpfe, die die Freundschaft verstärken, Knöpfe aus Holz, handbemalt und handbeschriftet, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe Mit ihrem Werk Tsemed Chemed – „dicke Freunde“ möchte die Künstlerin Lina Khesina die Schönheit der hebräischen Sprache zeigen und sie in den Alltag übertragen, genauer gesagt: sie im Alltag tragen.
Freundschaft zum Anfassen: Ein Gespräch mit Lina Khesina
Am 30. Juli ist Internationaler Tag der Freundschaft. Wie aber gedenken wir der Freundschaft? Oder wie können wir sie sichtbar machen? Dazu haben wir die Kommunikationsdesignerin Lina Khesina befragt. Sie hat zwei Freundschaftsknöpfe für den Kunstautomaten in unserer Dauerausstellung erfunden. Auf dem einen steht in hebräischer Schrift „Tsemed“, auf dem anderen „Chemed“.
Lisa Albrecht: Lina, warum hast du genau dieses Objekt für den Automaten entwickelt?
Lina Khesina: Ich hatte die Idee, die Schönheit der hebräischen Sprache zu zeigen und sie in den Alltag zu übertragen. Ich selbst spreche zwar kein Hebräisch, aber vom Klang her ist es für mich neben dem Spanischen die schönste Sprache. Ich wollte das Hebräische also auch für mich entdecken und Wortkonstellationen in dieser Sprache finden, mit denen ich spielen kann. Daraus sind dann die Knöpfe mit diesem Wortspiel entstanden.
Wie bist du auf dieses Wortspiel gekommen?
Im Russischen werden beste Freunde oft „nje rasléj wodá“ genannt, was so viel bedeutet wie „das Wasser kann diese Verbindung auch nicht zerstören“. Ich habe dann nachgeforscht, ob es im Hebräischen auch so eine Wendung gibt und daraufhin von „Tsemed Chemed“ erfahren. Das bedeutet wörtlich übersetzt etwa „süße Verflechtung“ oder „entzückendes Paar“ und im übertragenen Sinn „dicke Freunde“.
Was haben diese beiden Worte mit den Knöpfen zu tun?
Die Knöpfe werden mit einem Faden angenäht und gehen dann eine Verflechtung mit dem Stoff ein. Eine ähnliche Konstellation besteht auch zwischen Freunden, selbst wenn sie tausende Kilometer voneinander getrennt sind. Sie sind wie die Knöpfe durch Faden und Spruch miteinander verbunden.
Inwiefern spielt die Verbindung über Distanzen eine Rolle für dich?
Ich glaube, heutzutage haben wir alle irgendwo auf anderen Kontinenten Freunde, die wir nicht mehr so oft sehen. Natürlich gibt es jetzt die Verbindung über das Internet. Im Unterschied zu dieser kann man die Verbindung mit einem Freund durch einen Knopf aber auch anfassen. Das hat etwas Persönliches, etwas Schönes – wenn man den Knopf nicht sofort verliert.
Wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet Knöpfe zu entwerfen? Ansonsten arbeitest du ja vor allem als Illustratorin, oder?
Knöpfe können ein Symbol dafür sein, etwas mit etwas anderem zu verbinden. Im Grunde genommen haben sie sogar nur diese Funktion. Und obwohl ich Knöpfe gewählt habe, bin ich doch im Medium Illustration oder Grafikdesign geblieben – nur eben auf einem anderen Material. Aber eigentlich ist es dasselbe: Es ist Gebrauchsgrafik, kein bloßes Souvenir, das in ein Regal gestellt wird, sondern etwas, das eine Funktion hat und weiterleben kann.
Wie hast Du die Knöpfe genau hergestellt und bearbeitet?
Sie wurden mit einem Laser ausgeschnitten und haben am Anfang sehr schön nach Holz gerochen. Dann habe ich zuerst die eine Seite und dann die andere Seite gefärbt. Anschließend habe ich die Wörter hinzugefügt, zweihundertmal. Zur Sicherheit hab ich immer wieder geschaut, ob ich sie wirklich richtig schreibe, denn bei „Tsemed“ und „Chemed“ unterscheidet sich nur der erste Buchstabe. Zum Schluss habe ich die Knöpfe lackiert und sie dann verpackt.
Und was sollen unsere Besucher*innen mit den Knöpfen tun?
Wer diese zwei Knöpfe bekommt, hat entweder schon einen Freund neben sich stehen – weil man eher selten allein ins Museum geht – oder man hat jemanden im Kopf, mit dem man die Verbindung durch diesen Gegenstand noch verstärken möchte. Der Knopf kann zum Beispiel an ein Kleidungsstück, in ein Buch oder an einen Rucksack genäht werden, sodass man ihn immer dabei hat.
Trägst du selbst einen deiner Knöpfe?
Leider habe ich alle Knöpfe abgegeben. Aber wenn ich noch ein Exemplar hätte, würde ich es tragen.
Und wem würdest du den dazugehörigen Knopf geben?
Da fallen mir mehrere Leute ein. Aber dann ist es nicht mehr interessant. Man muss schon einen richtig-richtigen Freund finden, den einzigen, der das darf, damit man selbst auch nur einen Knopf hat. Ich glaube, ich würde den zweiten Knopf nach Weißrussland schicken zu einer Freundin, die mich zu vielen Sachen inspiriert. Sie ist Musikerin und Puppentheater-Regisseurin und wir machen zurzeit ein kleines Puppentheaterstück zusammen.
Apropos richtige Freundschaft: Was genau zeichnet denn „dicke Freunde“ für dich aus?
Unter richtigen Freunden kann man so sein, wie man ist – und nicht jemand anderes, so wie man es sich manchmal wünscht. Freunde zu haben ist wichtig, damit man sich selbst treu bleibt.
Vielen Dank für das Gespräch, Lina!
Lisa Albrecht, Medien
Mehr von und über Lina Khesina finden Sie auf ihrer Website www.flyingfly.de.
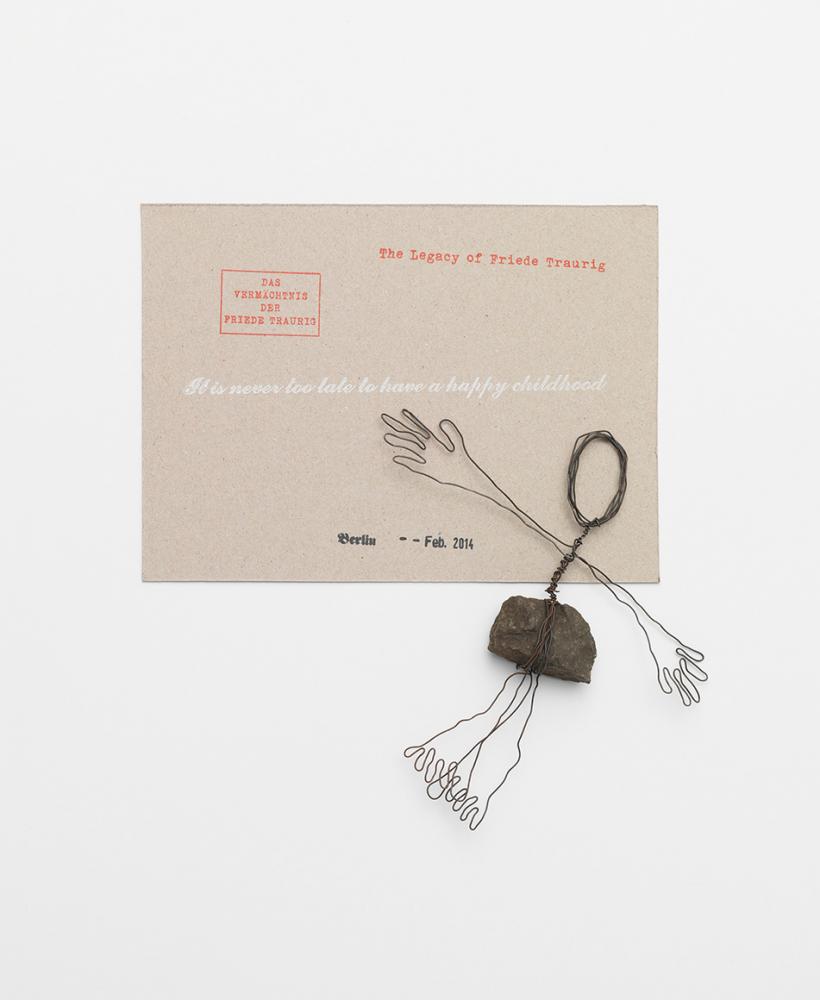
Deborah Wargon (*1962, Melbourne, Australien), Das Vermächtnis der Friede Traurig / The Legacy of Friede Traurig. It's never too late to have a happy childhood, Gleisschotter mit Draht umwickelt, Februar 2014; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe Als „Testamentsvollstreckerin“ setzt sich Deborah Wargon durch ihr Kunstwerk Das Vermächtnis der Friede Traurig. It's never too late to have a happy childhood mit den Reichtümern und dunklen Geheimnissen der Vermächtnisse auseinander.
Verwirrende Vermächtnisse: Deborah Wargons Werke für unseren Kunstautomaten holen unter den Teppich Gekehrtes hervor
Ein herzlicher Empfang, Duft nach frisch gekochtem Essen, ein hoher lichtdurchfluteter Raum voller bunter Bücher und Bilder und ein Klavier, auf dem ein Wegweiser nach Australien zeigt – mein erster Kontakt mit Deborah Wargon in ihrem Wohn-Atelier im Prenzlauer Berg passt so gar nicht zu den eher strengen und düsteren Assoziationen, die das Wort „Testamentsvollstreckerin“ bei mir auslöst. Diese Selbstbezeichnung gibt sich die 1962 in Melbourne geborene Musikerin, Theaterfrau und Bildende Künstlerin auf dem ,Beipackzettel‘ zu den kleinformatigen Kunstwerken, die sie für den Kunstautomaten in unserer Dauerausstellung geschaffen hat. Sie tragen den Titel Das Vermächtnis der Friede Traurig, und Deborah Wargon, die sonst vor allem für ihre Scherenschnitte in ehemaligen Insektenkästen bekannt ist, sagt dazu, dass sie eher traurig seien.
Wenn man mit etwas Glück eines ihrer Werke zieht, erhält man beispielsweise eine kleine menschliche Figur aus Gleisschotter, Draht und Zeitungspapier. Neben dem sprechenden Namen „Friede Traurig“ ruft auch das Material traurige Geschichten von Zugtransporten und Drahtzäunen auf, zumal es sich bei dem verwendeten Zeitungspapier um Zeitungen aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Doch nicht nur um die konkrete Zeit des Nationalsozialismus und der Schoa geht es der Künstlerin offenbar, sondern allgemeiner um die Vermächtnisse, das Erbe und die Geschichten, die wir alle mit uns herumtragen.
Ihre Materialwahl begründet sie nämlich so:
„Draht ist für mich ein spannendes Material. Es wird ja auch für Käfige verwendet. Man kann damit also andeuten, worin wir alle gefangen sind.“
Der am Boden liegende Gleisschotter wiederum habe für sie etwas mit dem Grund zu tun, auf dem wir als Nachkommen von Menschen, die vor uns da waren, alle gehen.
„Außerdem gibt es doch sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch das Sprichwort, ,etwas unter den Teppich zu kehren‘.“
Der Schotter, der durch unsere Schuhsohlen ins Haus getragen, dann aber unter den Teppich gekehrt wird, steht für etwas, womit wir uns nicht auseinandersetzen wollen.
Der in die Figuren eingearbeitete Schotterstein bildet demnach auch die Last von Vermächtnissen ab. So zeigen die individuell gestalteten Werke, dass diese Last mal im Kopf, mal im Magen oder Herz, mal im Unterleib sitzen kann. Versehen ist jede Figur mit dem augenzwinkernd aufmunternden Hinweis „It’s never too late to have a happy childhood“. Der mitreißend lebensfroh wirkenden Künstlerin nehme ich sofort ab, dass sie die Hoffnung, auf den verwirrenden Schichten von Geschichte(n) und Vermächtnissen etwas Eigenes, Lebenswertes aufzubauen, tatsächlich trägt.
Mit dem Erwachen der Hoffnung endet auch das Märchen, das die Künstlerin als Begleittext für den Kunstautomaten geschrieben hat und in dem es von Begriffen aus dem Gedächtnisdiskurs nur so wimmelt. Deborah Wargons Ururgroßmutter hieß tatsächlich Friede Traurig, doch wie der Name selbst schon an ein Gleichnis denken lässt, ist die Form des Märchens für sie eine Methode, dem Kunstwerk über die eigene Biografie hinaus Gültigkeit zu verschaffen und es anderen für ihre Deutungen zu öffnen. Beispielsweise für meine Lesart, im Motiv des Gebärens unter anderem eine Metapher für den künstlerischen Schaffensprozess zu sehen:
„Vor langer, langer Zeit kam die Zeit zum Mutterleib und sprach zu ihm, dass nun der rechte Moment zum Entbinden gekommen sei. Und so kam es, dass die Wasser brachen und der Mutterleib das Vermächtnis gebar.“
In der Tat sei es bei ihr so, antwortet die Künstlerin auf Nachfrage, dass sie mit Ideen für Kunstwerke sozusagen immer eine Weile ,schwanger gehe‘, bevor sie sie in die Welt setze. Insgesamt wundert sie sich aber, wenn ihr hier in Deutschland einige Leute sagen, ihre Kunst sei so ,weiblich‘. Schließlich beschäftige sie sich in ihren Scherenschnitten doch mit dem menschlichen Körper insgesamt, sowohl mit weiblichen als auch mit männlichen Formen.
Mein Blick fällt auf einen Scherenschnitt an der Wand, bei dem zwei Babys noch über die Nabelschnur mit dem Mutterkörper verbunden sind. Deborah Wargon erzählt, dass ihre künstlerische Beschäftigung mit Mutterschaft auch etwas mit ihrer Identität als Jüdin zu tun habe, womit sie sich seit ein paar Jahren verstärkt auseinandersetzt. Schon für die biblischen Stammmütter wie Sara oder Rebekka ist schließlich (die zunächst nicht zustande kommende) Mutterschaft ein wichtiges Thema.
Der Auseinandersetzung mit jüdischer Identität verdankt sich auch das zweite Werk Wargons im Kunstautomaten. Es trägt den Titel Eye of God und ist ein mit dickerem und glänzenderem Draht umwickeltes Stück Gleisschotter, das ein bisschen an Modell-Darstellungen von Atomen erinnert.
„Ich bin nicht religiös erzogen und glaube auch heute nicht an Gott. Wenn ich die zehn Gebote lese, kommt er mir eher eitel und patriarchal vor und hat etwas von Big Brother. Gleichzeitig finde ich diese mit Gott verbundene Hoffnung im Judentum aber gut und attraktiv. Auch Gott gehört also zu dem Schottergrund, auf dem ich als heutige Jüdin meine Identität aufbaue, nur bleibt er, wie ein für sich abgeschlossenes Atom, für mich letztlich unzugänglich.“
Mirjam Bitter, Medien
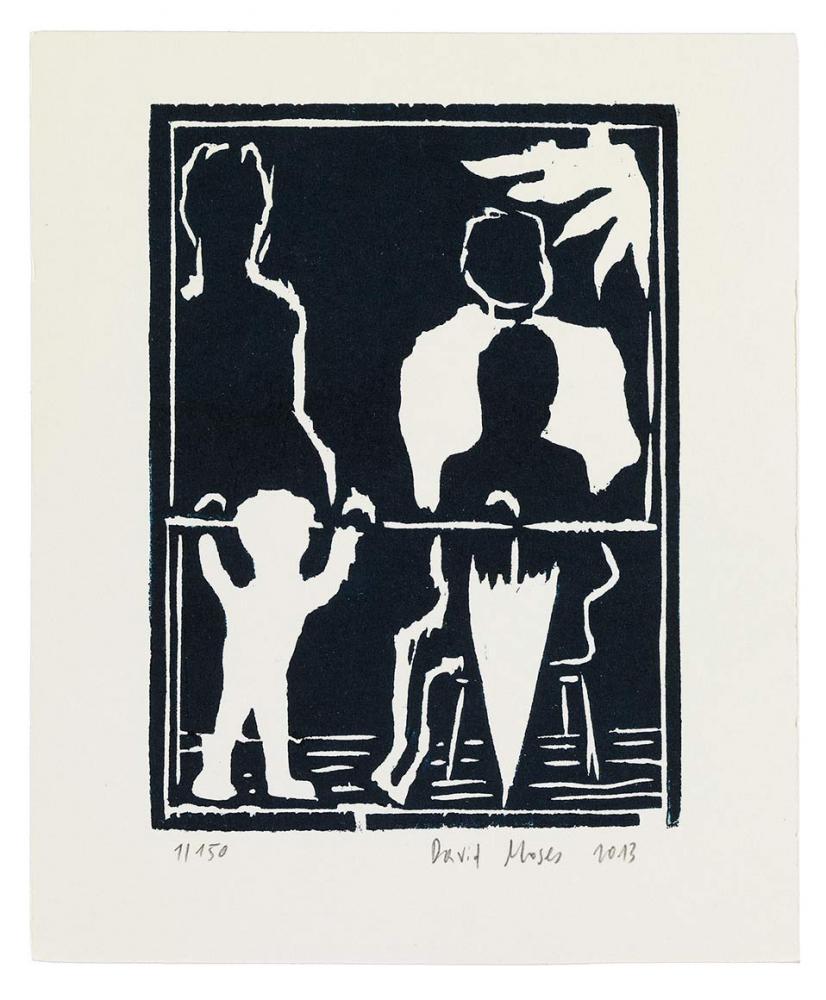
David Moses (*1983, Bonn, Deutschland), Der Balkon – 2013.DG.HD.13.9.0001, Holzschnitt in 150er Auflage, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe Der Holzschnitt Der Balkon ist eine künstlerische Auseinandersetzung von David Moses mit einer Radierung, die sein Großvater nach den Eindrücken eines Berlinbesuches 1963-64 anfertigte.
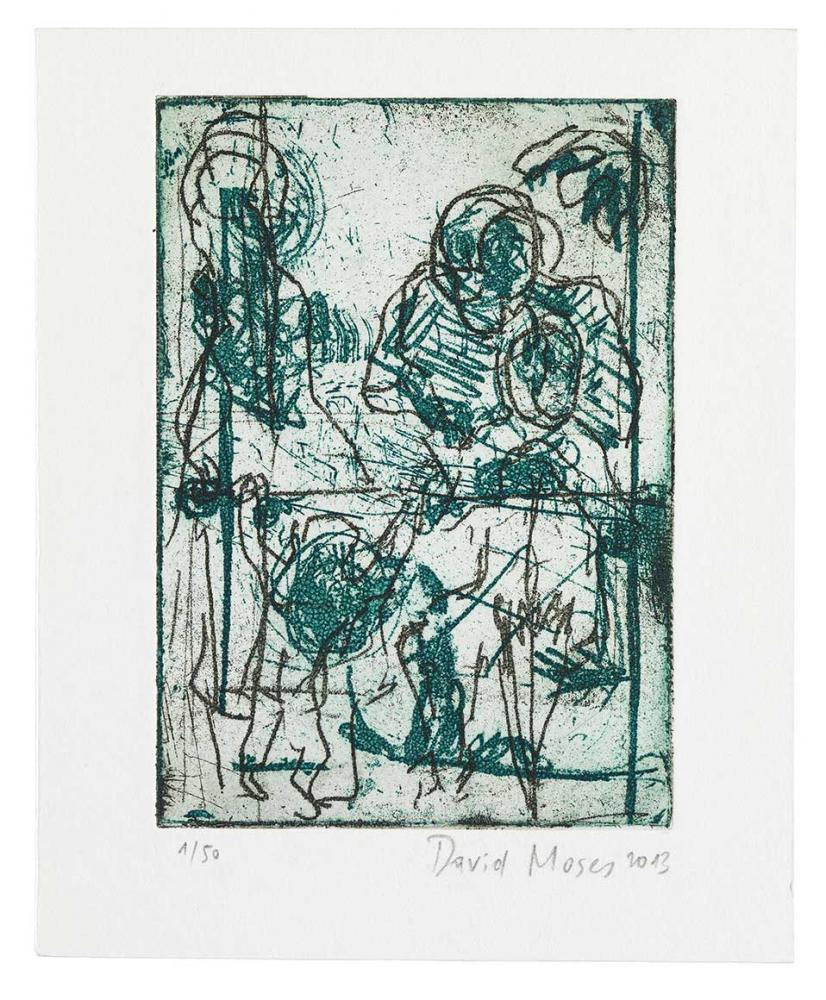
David Moses (*1983, Bonn, Deutschland), Der Balkon - 2013.DG.TD.13.9.0001, Farbradierung von zwei Platten in 50er Auflage, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe Auch für die Farbradierung Der Balkon hat sich David Moses vom Werk seines Großvaters inspirieren lassen.
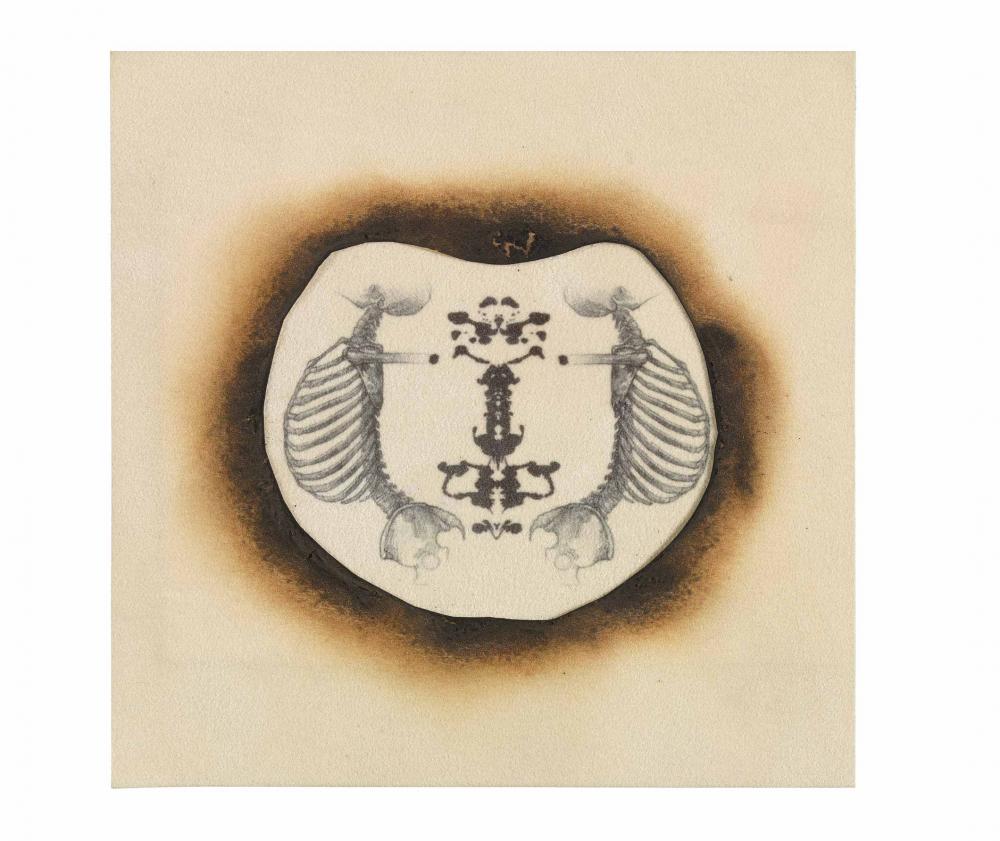
Victor Alaluf (*1976, Posadas, Argentinien), Essence, Siebdruck auf verkohltem Samt, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe Das Kunstwerk von Victor Alaluf zielt darauf ab, sowohl Zerstörung als auch Wiedergeburt auszudrücken, den Tod und das Leben, Struktur und Zerbrechlichkeit.
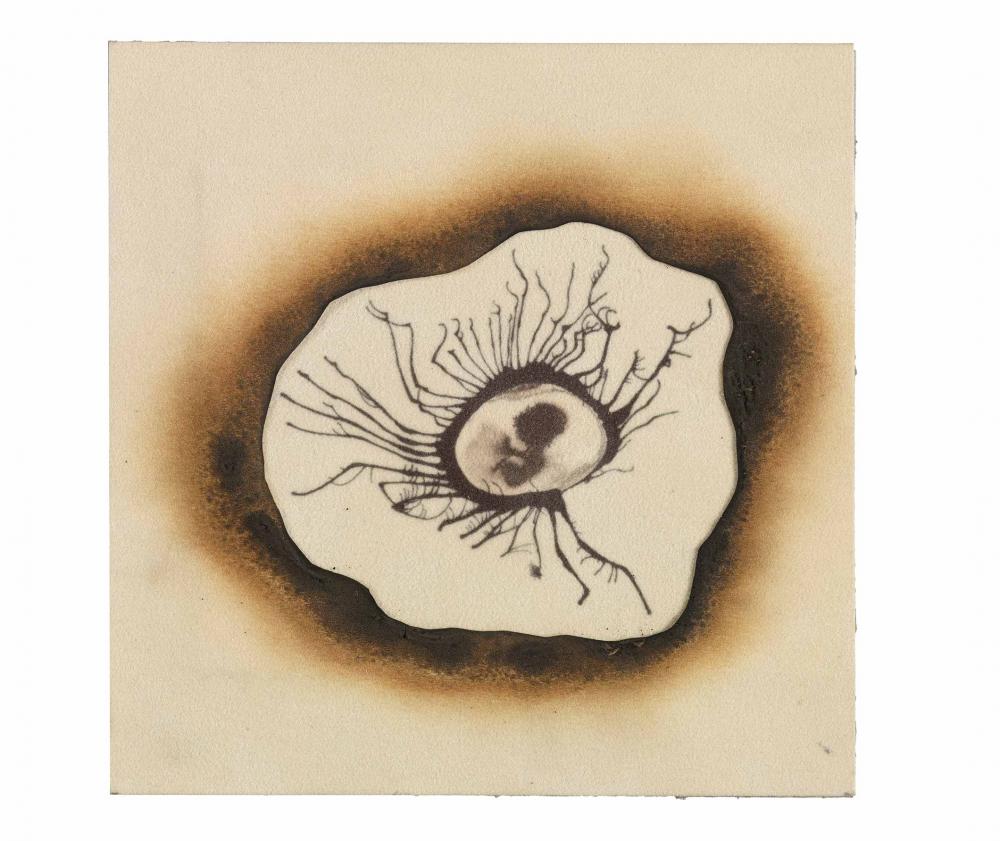
Victor Alaluf (*1976, Posadas, Argentinien), Essence, Siebdruck auf verkohltem Samt, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe
August 2013–August 2014
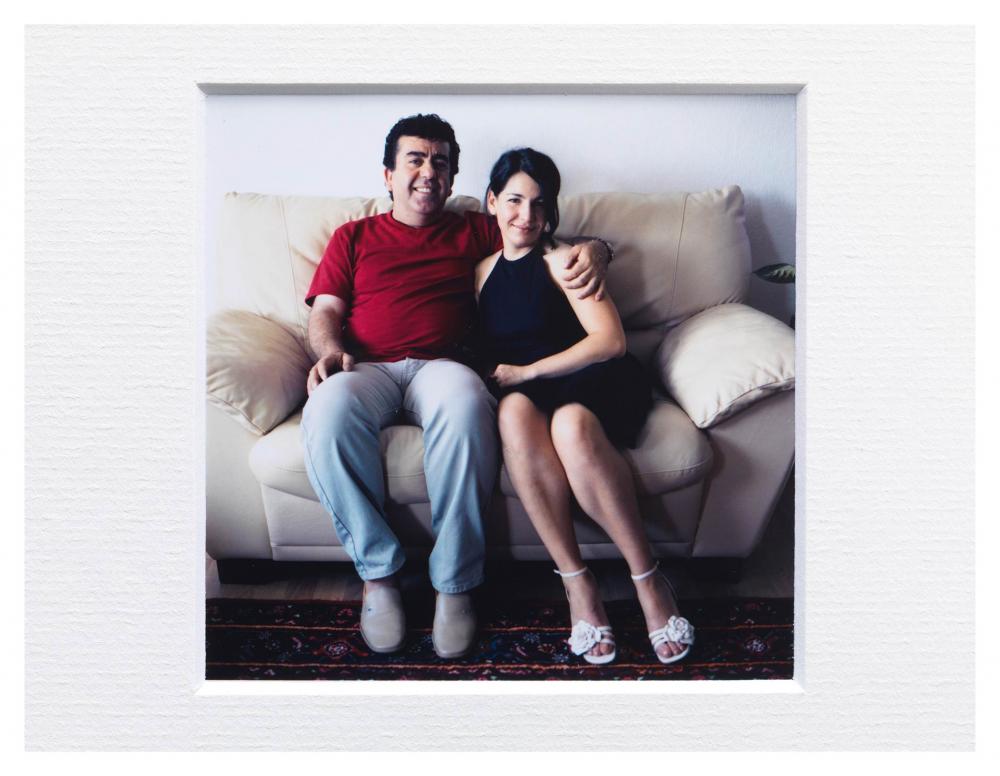
Mascha Danzis (*1972, Leningrad, Sowjetunion, heute: St. Petersburg, Russland), In den Armen ihrer Väter, Fotoserie mit 9 Fotos, 8 cm x 8 cm, passepartouriert, 2013, Originalserie 90 cm x 86 cm, gerahmt, 2007; Jüdisches Museum Berlin
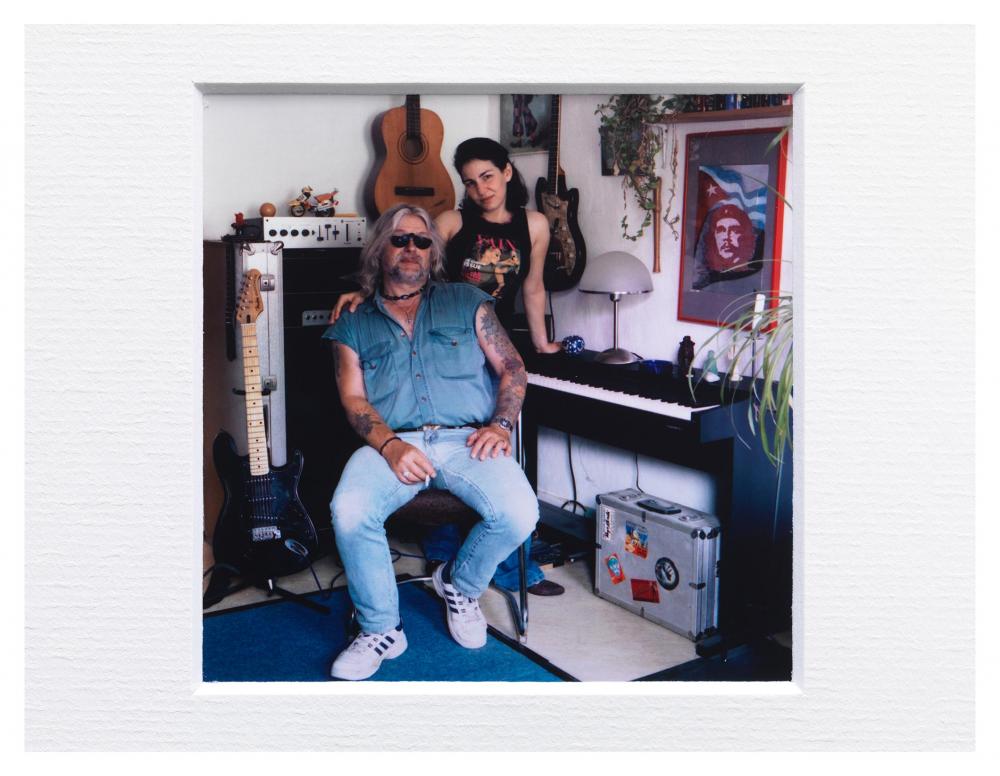
Mascha Danzis (*1972, Leningrad, Sowjetunion, heute: St. Petersburg, Russland), In den Armen ihrer Väter, Fotoserie mit 9 Fotos, 8 cm x 8 cm, passepartouriert, 2013, Originalserie 90 cm x 86 cm, gerahmt, 2007; Jüdisches Museum Berlin

Alexis Hyman Wolff (*1982, Los Angeles, USA), Wurzelkerze, Bienenwachs, Docht, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Andrei Krioukov (*1959, Moskau, Sowjetunion, heute: Russland), CocaCola, Dose aus Aluminium, zerdrückt, unterschrieben, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe
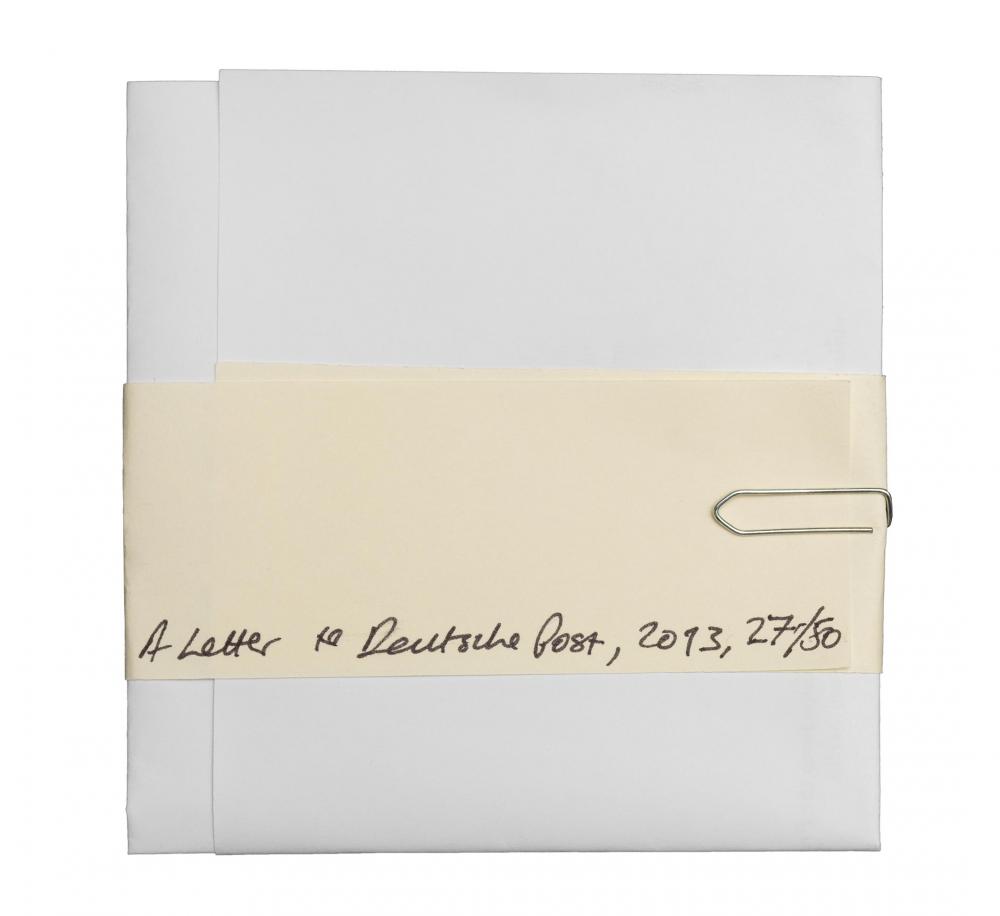
Alex Martinis Roe (*1982, Melbourne, Australien), Ein Brief an die Deutsche Post, A4 farbiger Tintenstrahldruck, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Zara Verity Morris (*1983, London, Großbritannien), The Mezuzah, Comic, digitaler Druck, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe

Atalya Laufer (*1979, Kibbuz Hazorea, Israel), The Guardian / Sycamore Group, 2013; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe



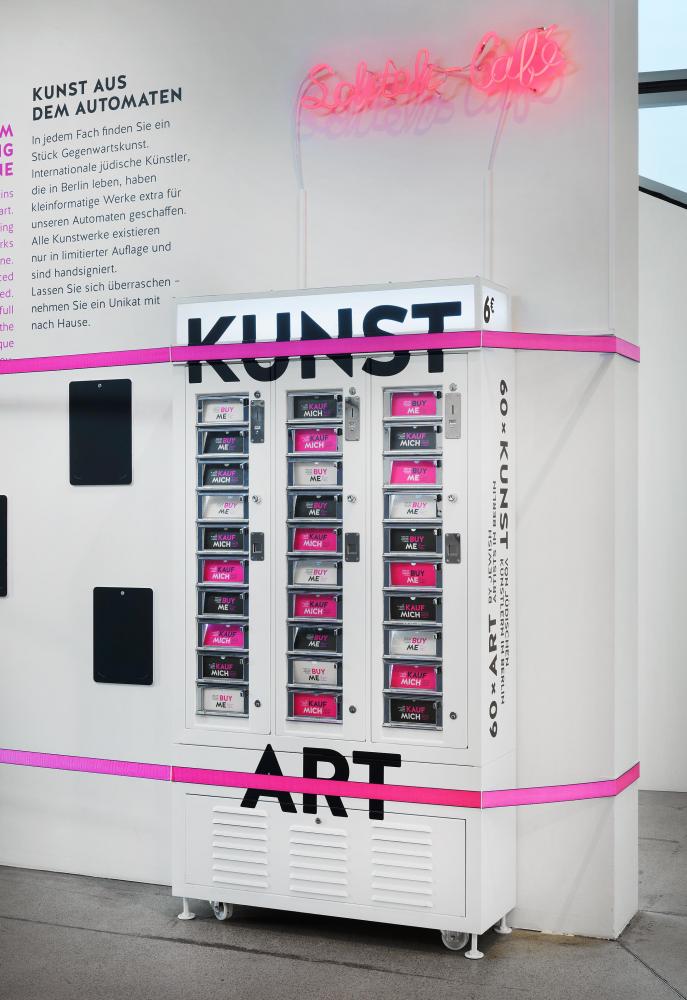 X
X


































































