„O-Töne sorgen für eine Vielfalt an Perspektiven“
Interview mit Lisa Albrecht über die neue JMB App

Zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Jahr 2020 launchte die JMB App. Sie erhielt 2024 ein Update und umfasst nun auch inklusive Angebot; Jüdisches Museum Berlin, Graphik: Verena Blöchl, NOUS
Die Bierbänke unter den Platanen im Museumsgarten des Jüdischen Museums Berlin sind fast leer. Wo normalerweise Besucher*innen eine Pause machen, sitzt Lisa Albrecht. Sie ist die Projektleiterin für die JMB App, die parallel zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Spätsommer launcht. Wie wird ein Audioguide in App-Form entwickelt? Mit welchen Methoden kann im Arbeitsprozess geprüft werden, ob die App die Bedürfnisse der Nutzer*innen erfüllt? Während die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, erzählt Lisa vom Arbeitsprozess, Methoden aus dem Design Thinking und ihrer Begeisterung für Audioformate.
Die JMB App löst ab Eröffnung der Dauerausstellung den Audioguide ab. Warum heißt der Guide JMB App?
Unser Audioguide heißt JMB App, weil er eine App für das ganze Museum ist. Neben der Dauerausstellung bespielen wir die Achsen im Untergeschoss des Libeskind-Baus, die Gärten und die Architektur. Und perspektivisch wollen wir auch Inhalte für Wechselausstellungen anbieten.
Warum ist er kein reiner Audioguide mehr?
Neben Audios können User*innen auch Texte lesen, Spiele spielen sowie Videos und Bilder anschauen. Die Besucher*innen erfahren über die App, wo sie sich gerade befinden. So können sie sich im Museum orientieren. Außerdem könnten wir in einer weiteren Ausbaustufe der App Veranstaltungen ankündigen oder Museumstickets verkaufen. Um diese Vielfalt an Formaten und Features anzubieten, ist eine App am geeignetsten.
 X
X
Nach Stationen am Deutschen Hygiene-Museum und beim WDR ist Lisa Albrecht nun verantwortlich für die JMB App; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Immanuel Ayx
In einem älteren Artikel in der Süddeutschen Zeitung warnt der Autor vor einer „Schwächung der Autonomie des Ausstellungsstücks“ und dass alle Besucher*innen nur noch auf kleine Bildschirme starren. Wie können App-Macher*innen mit dem Audioguide das Ausstellungserlebnis ergänzen?
Über diese Frage haben wir uns viele Gedanken gemacht. In der Dauerausstellung stehen viele Medienstationen, zu denen wir mit der App nicht in Konkurrenz treten wollten. Deswegen bieten wir auf der ersten Ebene immer Audios an. Um die Autonomie der Besucher*innen und der Ausstellungsstücke zu stärken, startet die App Inhalte nicht automatisch. Die Besucher*innen entscheiden selber, wie sie die App nutzen. Formulierungen, die die Wahrnehmung beeinflussen, habe ich bei den Textkorrekturen gestrichen. Da war ich relativ streng. Denn die App ist ein Angebot, das den Ausstellungsrundgang mit zusätzlichen Angeboten bereichert, ihn aber nicht ersetzt.

Die App setzt in der Dauerausstellung unterschiedliche Schwerpunkte, zum Beispiel Biografien. Eine von ihnen ist die von Günter Loewinski.
Text zum Mitlesen: Günter Loewinski – Boxen als Selbstverteidigung
Günter Loewinski war elf Jahre alt, als sein Vater ihm riet, einen Verteidigungssport zu lernen.
Günter Loewinski: „Seine Parole war, meinte er: ‚Jude sein heißt Kämpfer sein‘.“
Verteidigung? Kämpfer? Günter Loewinski, Jahrgang 1922, verstand zuerst nicht, worauf der Vater hinauswollte. Doch er fand Gefallen an seinem neuen Hobby: dem Boxen.
Sound: Geräusche Training: dumpfe Schläge auf Sandsack, Atmen, Rufe Trainer_
Günter Loewinski: „Und wir kamen zu einem Boxclub, der hieß JBC Berlin – Jüdischer Boxclub Berlin.“
Max Buchbaum, ein bekannter Jugendtrainer, nahm ihn unter seine Fittiche. Bald schon siegte Loewinski in überregionalen Turnieren der jüdischen Sportverbände. Mit 14 Jahren wurde er Meister bei einem Jugendboxturnier in Essen. Als Auszeichnung bekam er von seinem Trainer eine sehr persönliche Trophäe:
Günter Loewinski: „Und dann sagt er zu mir: ‚Du, hier hast du eine von meinen Trophäen. Ich habe deinen Namen draufgedruckt. Du bist der beste Jugendkämpfer von Essen gewesen.‘“
Loewinski machte eine Schneiderlehre. Weil er einen jüdischen Vater und eine nichtjüdische Mutter hatte, musste er ab 1939 jedoch als sogenannter „Mischling zweiten Grades“ Zwangsarbeit leisten. Eines Tages war er mit seiner Freundin Hannelore in der Berliner U-Bahn unterwegs:
Günter Loewinski: „Wir gingen die Treppe von der Untergrundbahn herauf und da kommt uns entgegen ein betrunkener SA-Mann in voller Uniform! Er war ganz, ganz schön betrunken! Sie war Mischling ersten Grades. Ich war Mischling zweiten Grades. Sie brauchte keinen Stern tragen. Und er hat sie angepöbelt. Und ich sage: ‚Hannelore, guck mal, ob jemand auf der Straße ist.‘ Und ich habe ihm ein Ding gegeben mit der rechten Faust, da ist er runtergepoltert die Treppen. Wir haben natürlich Angst bekommen. Wir sind im ersten, besten Hausflur hereingerannt und haben dort zwei, drei Stunden gestanden. Und ich bin nach Hause gekommen, das meinen Eltern erzählt, und meine Mutter war aufgeregt. Der sich gefreut hat, das war mein Vater!“
Bei der Produktion der JMB App habt ihr mit den unterschiedlichsten Abteilungen zusammengearbeitet. War das herausfordernd?
Wenn viele Menschen involviert sind, erfordert das viel Kommunikation, damit alle Stakeholder*innen und Dienstleister*innen miteinbezogen werden. Ich bin froh, dass die JMB App ein Schnittstellenprojekt ist. Wir haben neben den Kurator*innen auch mit dem Gebäudemanagement, dem Marketing, der Website und den externen Agenturen Antenna Audio und Nous zusammengearbeitet. Dadurch haben wir viele Kolleg*innen kennengelernt.
Ihr habt Texte über die Dauerausstellung geschrieben, als diese noch nicht aufgebaut war. Wie habt ihr über Räume geschrieben, die ihr euch nicht anschauen konntet?
Die Kurator*innen haben uns zu den Stationen, die wir für die JMB App ausgewählt haben, Materialpakete zusammengestellt. Neben Objektansichten, Artikeln und Hintergrundmaterial standen uns Texte zu Objekten zur Verfügung, die wir bereits in der alten Dauerausstellung gezeigt haben. Wir haben den Redaktionsprozess so gestaltet, dass die Kurator*innen die Texte geprüft haben. Aber wir haben auch vor Ort getextet, wenn das möglich war. So sind zum Beispiel die Texte zu den Gärten und zur Architektur entstanden.

In dem Audio-Track über die Gärten des Jüdischen Museums Berlin kommen der Gartenarchitekt Hans Kollhoff und die Landschaftsgestalter*innen Cornelia Müller und Jan Wehberg zu Wort.
Text zum Mitlesen: Museumsgärten – Garten am Altbau
Hans Kollhoff: „Es findet hier ziemlich viel auf kleinem Raum statt, anders als in barocken Gärten“
Jan Wehberg: „die Ideensetzung zum Paul-Celan-Hof“
Kollhoff: „rotes Herbstlaub“
Wehberg: „zu ... dem Paradiesgarten“
Cornelia Müller: „diese Ruhe und die Kontemplation zu finden“
Kollhoff: „die Hecken, die immer grün sind“
Wehberg: „wichtig ist die Gesamtheit und die Gesamtwirkung.“
Genau genommen sind es zwei verschiedene Gärten. Ein Garten hier am Altbau und einer um den Libeskind-Bau herum. Zwei Museumsgebäude – zwei Gärten.
Der Teil des Gartens, in dem Sie sich gerade befinden, ist in den 1980er-Jahren entstanden. Die Architekten Hans Kolhoff und Arthur Ovaska haben ihn für den barocken Altbau angelegt. Im Altbau befand sich damals noch das Berlin-Museum, mit Ausstellungen zur Stadtgeschichte. Das Projekt war Teil der Internationalen Bauausstellung von 1987, wie auch die Wohnhäuser an der Längsseite des Gartens – von Ihrem Standpunkt aus auf der linken Seite. Den Libeskind-Neubau gab es zu dieser Zeit noch gar nicht und der Hof war noch nicht verglast. Hans Kollhoff erinnert sich:
Hans Kollhoff: „Wichtig war für uns, wenn man aus dem Hof des Berlin-Museums Richtung Osten schaut, dass sich n Relief bildet und dass das hochgeht, und dass man dann auch das Bedürfnis hat dahinter zu gehen, die Treppe hoch zu gehen und von oben dann zurückzuschauen.“
An viele repräsentative Gebäude des Barock schließt sich eine Gartenanlage an. Dieses Prinzip haben Kollhoff und Ovaska hier aufgegriffen. Sicher kennen Sie andere barocke Gärten wie den von Schloss Versailles? Es sind künstliche Gebilde. Gezähmte Natur. Mit geometrisch beschnittenen Hecken und Bäumen, mit Fontänen und Wasserbecken, mit symmetrischen Achsen. Schauen Sie sich um! Durch den runden Laubengang können Sie hindurchgehen, weiter in den Garten hinein.
Welche Inhalte haben dich bei der Textarbeit besonders gefesselt?
In der Dauerausstellung werden viele spannende Geschichten erzählt. Das Flamencokleid von Sylvin Rubinstein hat mich besonders fasziniert.
Was war daran so faszinierend?
Das Exponat sorgt im ersten Moment für Irritation: Warum wird im Jüdischen Museum ein Flamencokleid ausgestellt? In der JMB App erzählt dann ein kurzer Track etwas über den Träger des Kleides: Der Flamenco-Tänzer Sylvin Rubinstein ist nämlich nach dem Verschwinden seiner Zwillingsschwester in Kleidern aufgetreten, um ihr nahe zu sein. Außerdem konnte er sich so tarnen und hat als Frau verkleidet Anschläge im Widerstand verübt. Das ist eine sehr bewegende Geschichte. Und der Vorteil beim Hören ist, dass man sich währenddessen das Kleid in der Ausstellung in Ruhe ansehen kann.

Besucher*innen erfahren in der JMB App mehr über Sylvin Rubinsteins außergewöhnliches Leben.
Text zum Mitlesen: Sylvin Rubinstein – Dolores und Imperio
_Musik: Flamenco_
Sylvin Rubinstein: „[D]er Flamenco hat uns gelegen! [...] Er ist sephardisch, er ist maurisch, und die Zigeuner haben ihn gewahrt. […] Wenn ich habe getanzt, ich habe gehabt mein Schwesterlein immer dabei.“
Sylvin Rubinstein hatte ein außergewöhnliches Leben. In Russland geboren, in Polen aufgewachsen, feierte er mit seiner Zwillingsschwester Maria in den 1930er-Jahren Triumphe. Als „Dolores und Imperio“ tanzten sie sich durch ganz Europa. Den Kriegsbeginn erlebten sie in Warschau, ein Jahr später wurden sie in das Warschauer Ghetto eingewiesen.
Sylvin Rubinstein: „[H]ier finden wir nur den Tod.“
Sie flohen – und mussten sich kurz darauf trennen: Maria sollte die Familie nachholen, doch der Plan ging nicht auf. Sylvin sah Maria nie wieder. Er ging in den Widerstand, half Gefangenen, versteckte jüdische Kinder – und plante Attentate. Als Sängerin verkleidet warf er zwei Handgranaten ins Publikum eines vornehmlich von SS und Gestapo besuchten Lokals. Kurz darauf floh er mit falschen Papieren nach Berlin. Hier erlebte er die Befreiung.
Den Verlust seiner Schwester überwand Sylvin Rubinstein nie. Fortan übernahm er ihre Rolle beim Tanz: Er nähte sich Flamencokleider und trat in Varietés in ganz Deutschland auf: Als Dolores knüpfte er an seine früheren Erfolge an – allerdings allein. Nie wieder tanzte er mit einer Partnerin.
Sylvin Rubinstein: „Aber Gott mir hat gegeben den Flamenco. Und wenn ich habe getanzt, er mir hat gegeben mein Schwesterlein immer dabei.“
Für die App habt ihr viele Interviews geführt. Warum ist das wichtig?
Schon beim vorherigen Audioguide haben wir viel mit Originaltönen gearbeitet. Das hat die Inhalte bereichert und ist gut bei den Besucher*innen angekommen. Mit O-Tönen sorgen wir für eine Vielfalt an Perspektiven und vermeiden eine einseitige Museumsperspektive. Wir haben zum Beispiel den Architekten Daniel Libeskind und die Künstlerin Yael Bartana interviewt.
Daniel Libeskind über die Voids, die das Gebäude des Jüdischen Museums Berlin durchziehen (in englischer Sprache); Jüdisches Museum Berlin 2017
Wie ist das Gefühl, wenn die fertigen Texte von den Sprecher*innen im Studio eingesprochen werden.
Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Als ich im Studio saß, habe ich den nicht immer leichten Redaktionsprozess vergessen. Wenn viele Personen an der Textredaktion beteiligt sind, macht das die Texte nicht unbedingt besser. Umso schöner war es zu merken, dass der Text gesprochen funktioniert. Außerdem haben wir tolle Sprecher*innen wie Heike Warmuth, Elmar Börger, Stephan Buchheim und Robert Frank. Besonders gefreut habe ich mich, dass wir Sandra Hüller für das Projekt gewinnen konnten. Sie hat den Texten bei den Aufnahmen eine persönliche Note gegeben.

Sandra Hüller bei den Aufnahmen für die JMB App; Jüdisches Museum Berlin, Foto: Heiko Niebur
Wann und wie hast du das Thema Audioguide für dich entdeckt?
Als ich 17 Jahre alt war, habe ich einen Sommer als Au-pair in Madrid gearbeitet und mich in meiner freien Zeit gelangweilt. Daher war ich ständig in den Museen und habe mir, um mein Spanisch zu verbessern, Audioguides angehört. Ich fand es schon damals sehr schade, dass dieses tolle Medium oft so unkreativ umgesetzt wird.
Hast du dann ein Studium in diese Richtung gewählt?
Nach dem Abi habe ich überlegt, ob ich Ton an der Filmhochschule studiere, habe mich dann für ein geistes- und sprachwissenschaftliches Studium entschieden und nebenher Praktika beim Radio und eigene Audioprojekte gemacht. Meine Bachelor-Arbeit habe ich über einen Audiowalk der kanadischen Künstlerin Janet Cardiff geschrieben und als Master-Arbeit dann selbst den künstlerischen Audiowalk Hör-Spuren durch den Ernst-Thälmann-Park in Berlin produziert.
Welche Tipps würdest du Leser*innen geben, die App-Macher*innen werden wollen?
Kritisch Audioguides nutzen und hören. Es gibt zum Beispiel tolle Projekte vom Rimini Protokoll und einige Zeit gab es ein Spaziergangs-Festival der Plattform B-Tour.
Das Jüdische Museum Berlin hat unterschiedlichste Besucher*innen. Alle Altersgruppen und unterschiedliche Nationalitäten sind vertreten. Wie habt ihr euch in eurem Arbeitsprozess diesen potentiell diversen Nutzer*innen angenähert?
Wir haben aus dem Design Thinking Toolkit die Methode der Persona angewendet. Bei dieser Methode skizziert man mögliche Nutzer*innen und versucht damit die Bandbreite an unterschiedlichen Museumsbesucher*innen abzudecken.
Wie sieht so eine Persona aus?
Bei der App haben wir unter anderem den 16-jährigen Bruno entwickelt, der mit seinen Eltern ins Museum kommt und gelangweilt ist. Eine weitere Persona ist Gertrud. Sie ist 70 Jahre alt, hat sich schon mit dem Thema befasst und ist an vertiefendem Wissen interessiert. Wenn man Personas aussucht, die extrem unterschiedlich sind, kann man im Produktionsprozess anhand der Personas regelmäßig prüfen, ob die App die unterschiedlichen Nutzer*innenbedürfnisse erfüllt – ob für die unterschiedlichsten Besucher*innen, was dabei ist.
Eine besonders wichtige Zielgruppe für das Museum und die App sind Besucher*innen mit Behinderungen. Können sie die App nutzen?
Für die erste Version der App haben wir als Zielgruppe blinde und sehbehinderte Besucher*innen gewählt. Wir haben darauf geachtet, dass die Audios auch funktionieren, wenn die Besucher*innen die Objekte nicht sehen. Die App liest außerdem alle Schrifttexte vor und bietet Tastanleitungen für Tastgemälde. Besucher*innen mit Höreinschränkung bieten wir alle Audio-Texte zum Mitlesen an. Das ist ein minimales Angebot, das für zukünftige Versionen noch ausgebaut werden soll.
Kannst du ein besonderes Format nennen, das sich speziell an Besucher*innen mit Blindheit und Sehbehinderung richtet?
Wir haben für einige Stationen unserer Architektur-Tour den blinden Museumsguide Jonas Hauer interviewt. Dadurch konnten wir in O-Tönen seine Perspektive auf den Raum integrieren. Das ist auch für sehende Besucher*innen ein Mehrwert.

Für blinde Besucher*innen ist der Garten des Exils einer der überschaubarsten Orte. Warum das so ist, erklärt der blinde Museumsguide Jonas Hauer.
Text zum Mitlesen: Garten des Exils – „Der überschaubarste Ort“
Jonas Hauer: „Der Garten des Exils, der war für mich immer der Punkt, wo sich sehende und blinde Besucher tatsächlich voneinander scheiden. Weil für sehende Besucher weiß ich, dass das der verwirrendste Ort ist, für blinde Besucher ist das der überschaubarste Ort. Das liegt daran, dass Sehende sich ja optisch ja orientieren und einfach dadurch, dass da alles gekippt ist und man irgendwann gar nicht mehr weiß, was ist denn eigentlich gekippt – die Pfeiler? Der Boden? Ich selbst? Es ist sehr schwierig, sich zu orientieren.
Für mich ist diese Struktur fantastisch, weil die Pfeiler haben alle die gleiche Größe, sie haben alle den gleichen Abstand zueinander. Der Garten hat eine quadratische Grundfläche. Der Garten ist in sich nochmal gekippt und zwar sogar doppelt gekippt. Also, eine Ecke ist der tiefste Punkt, was für mich super ist, weil ich nämlich weiß, wenn ich wieder raus will, gehe ich einfach nach unten. Das einzige, was ein bisschen stört, ist der Boden, der ist sehr uneben. Wenn der jetzt noch glatt wäre, dann wäre das für mich die perfekte Struktur.
Und für mich war das immer ... Ich konnte mich immer entspannen in diesem Garten, und für Sehende es ist immer genau der Unterschied, war das andere Extrem sozusagen gewesen. Das ist schön, weil es auch das Exil irgendwie noch mal ganz anders beleuchtet. Also, ich kenne mich nicht aus mit Exil, aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Exil tatsächlich diese Strukturen geben kann, also dass man durch eine neue Orientierung vielleicht auch eine Festigkeit erleben kann, die man jetzt so in seinem Herkunftsland oder in seinem alltäglichen Leben vielleicht nicht so wahrnimmt und die vielleicht für andere Leute, die von draußen drauf gucken oder vielleicht mit einem anderen Sinn darauf gucken, vielleicht viel eher wahrzunehmen ist.“
Ich bin ein besonders ungeduldiger Museumsbesucher. Hat die JMB App Touren, die ich in kurzer Zeit schaffen kann?
Die Ausstellung hat eine Fläche von mehr als 3.000 Quadratmetern. Um die ganze Ausstellung anzuschauen, bräuchte ein*e Museumsbesucher*in wahrscheinlich einen ganzen Tag. Gerade deswegen haben wir für Museumstypen mit wenig Zeit kurze Touren entwickelt. Außerdem könntest du frei flanieren und dir nur die Audio-Tracks anhören, die dich interessieren.
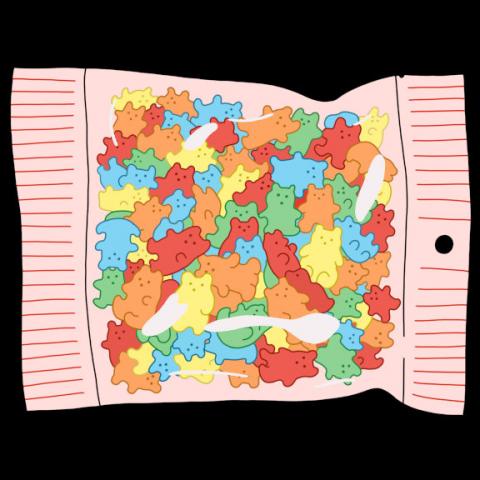
Was ist eigentlich Kaschrut? Der Audio-Track erklärt das jüdische Speisegesetz.
Text zum Mitlesen: Kaschrut – Die Speisegesetze
_Jingle_
Was ist eigentlich …
… Kaschrut?
Kaschrut, das Speisegesetz, regelt die rituelle Reinheit der Nahrung – also was koscher ist und gegessen werden darf.
Grundlage der Kaschrut ist die Tora. Eine Fülle von Regeln bestimmt, was auf den Teller kommt – und was nicht.
Erlaubt sind alle Früchte, Gemüse und Getreidearten. Bei Fleisch und Fisch wird es allerdings komplizierter.
Koscher, also tauglich, ist Fleisch von Wiederkäuern mit gespaltenen Hufen wie Rind oder Lamm. Allerdings nur unter einer Bedingung: Das Tier muss auf koschere Weise geschlachtet worden sein: Das heißt, mit nur einem Schnitt.
Nicht koscher ist zum Beispiel das Fleisch von Schweinen und Kaninchen. Auch Geflügel und Fisch kommen nicht wahllos auf den Speiseplan. Vögel dürfen keine Aasfresser sein und Wassertiere müssen Gräten und Schuppen haben, um als Nahrung zu dienen.
In der Tora steht auch: „Du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen“. Darum werden Fleisch- und Milchprodukte nicht zusammen gegessen. Cheeseburger und Lasagne sind also tabu.
Wie ernst man die Kaschrut nimmt und wie streng man sie befolgt, berührt den Kern der eigenen Identität. Für den italienischen Autor Primo Levi bedeutete dies: „[E]in Jude ist, […] wer keine Salami essen sollte, aber es doch tut[.]“
Warum sollten Besucher*innen sich vor ihrem Museumsbesuch die JMB App auf ihr Smartphone laden?
Wenn Besucher*innen ihr eigenes Gerät und Kopfhörer mitbringen, hat das mehrere Vorteile. Die meisten Menschen kennen sich auf ihrem eigenen Gerät gut aus. Die App stellt außerdem eine Statistik bereit, in der die geschafften Stationen, die durchlaufenen Jahrhunderte, die gespielten Spiele und die gehörten Minuten gezählt werden. Zudem haben User*innen die Möglichkeit, Favoriten zu speichern. So können sie dann zu Hause Stationen nachholen, für die sie in der Ausstellung keine Zeit hatten. Die App ist übrigens kostenfrei.
Das Interview führte Immanuel Ayx, Juli 2020
Zitierempfehlung:
Immanuel Ayx (2020), „O-Töne sorgen für eine Vielfalt an Perspektiven“. Interview mit Lisa Albrecht über die neue JMB App.
URL: www.jmberlin.de/node/7143





