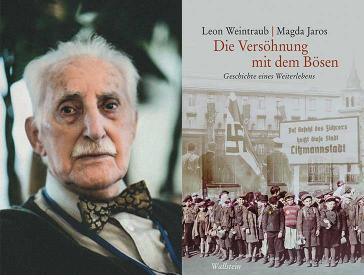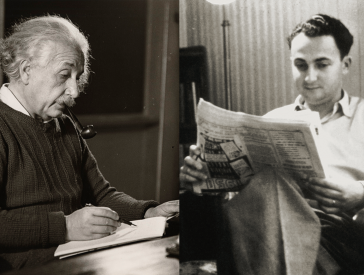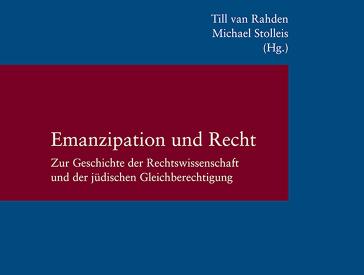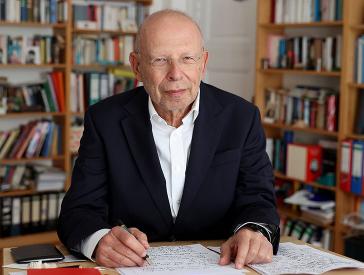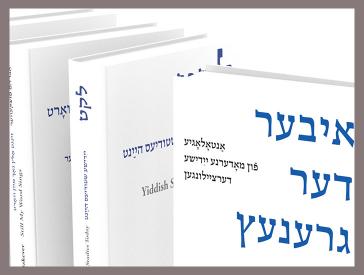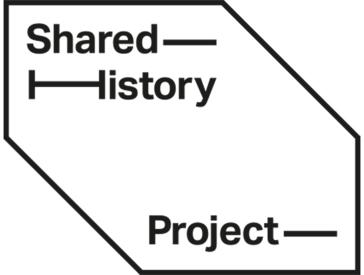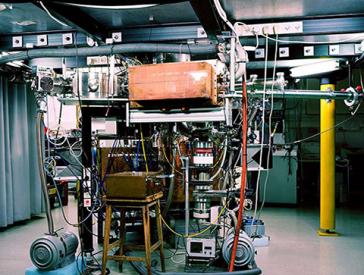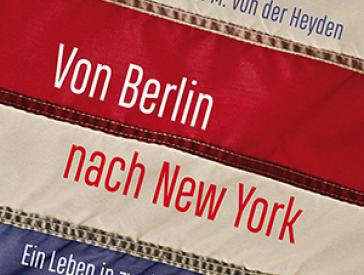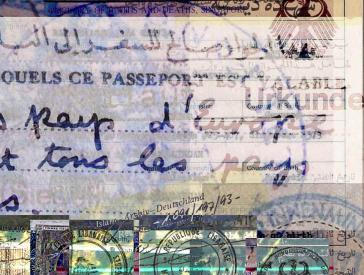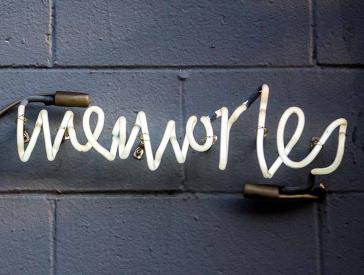KOLOT – קולות – Stimmen
Perspektiven auf den 7. Oktober (mit Video-Mitschnitt)
Das Massaker am 7. Oktober 2023 bedeutet für die israelische und jüdische Gemeinschaft weltweit eine tiefe Zäsur. Das Projekt KOLOT hat einige Stimmen aus der Community dokumentiert und in Form von narrativen Videointerviews aufgezeichnet. Ein Jahr nach dem Angriff stellte KOLOT erstmals Ausschnitte dieser Interviews vor.
Mitschnitt verfügbar

Wo
W. M. Blumenthal Akademie,
Klaus Mangold Auditorium
Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 1, 10969 Berlin
(gegenüber dem Museum)
Video-Mitschnitt vom 9. Okt 2024; OFEK e.V.
Rede von Hetty Berg, Direktorin des JMB, bei der Veranstaltung
Sehr geehrte, liebe Marina Chernivsky,
sehr geehrte Ruthe Zuntz, sehr geehrte Erica Zingher, sehr geehrte Lea Wohl von Haselberg, sehr geehrter Kurt Grünberg und sehr geehrter Dimitrij Kapitelman,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste von OFEK und dem Jüdisches Museum Berlin,
ich möchte Sie sehr herzlich in der W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin begrüßen.
Es bedeutet mir viel, dass wir als Gastgeberin und Kooperationspartnerin mit OFEK e.V. diesen Abend ausrichten können.
Es ist oft gesagt und geschrieben worden, dass der 7. Oktober 2023 ein Datum sei, das eine Zäsur markiere. Das ist richtig und gilt auch für das Leben der Jüdinnen und Juden in Deutschland, für das Jüdische Museum Berlin als Institution und für die Mitarbeiter*innen des Museums. Mit Trauer und Entsetzen verfolgen wir seit dem Massaker der Hamas die Gewalt im Nahen Osten. Der 7. Oktober ist eine Zäsur – und gleichzeitig eine Fortsetzung. Leid, Unsicherheit und Erschütterung wachsen weiter. Unsere Gedanken sind bei den Geiseln der Hamas, die heute bereits unvorstellbare 367 Tage in der Hand von Terroristen sind. Wir denken an ihre Familien und alle Menschen in der Region, die unverschuldet unter der aktuellen Situation leiden. Eine Lösung ist nicht in Sicht.
Der heutige Abend ist dem Gedenken des 7. Oktobers gewidmet.
Wir werden Ausschnitte aus verschiedenen Videointerviews aus dem Projekt KOLOT sehen, die nach dem Angriff der Hamas auf Israel mit Menschen aus jüdischen und israelischen Communities in Deutschland geführt und aufgezeichnet worden sind – Marina Chernivsky wird gleich mehr dazu sagen. Diese Ausschnitte sind Momentaufnahmen, denen – über ihren jeweiligen Inhalt hinaus – ein eigener Wert als persönliche Zeugnisse eben dieses Moments der Erinnerung, des Rückblicks und der Reflexion zukommt.
Und sie können uns helfen, diesen Moment und den jeweils individuellen Blick darauf zu verstehen. Als Teil der Kooperation mit OFEK e.V. gehen diese Videointerviews in unsere Sammlung im Jüdischen Museum Berlin ein, worüber wir uns sehr freuen.
Ich zitiere Primo Levi, Das Erinnern der Wunde, erschienen 1986:
„Die menschliche Erinnerung ist ein wunderbares, aber unzuverlässiges Instrument. Das ist eine abgedroschene Wahrheit, die nicht nur den Psychologen, sondern auch jedem bekannt ist, der sein Augenmerk auf das Verhalten seiner Umgebung oder sein eigenes gerichtet hat. Die in uns schlummernden Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt; sie zeigen nicht nur die Neigung, sich mit den Jahren zu verflüchtigen, oft verändern sie sich oder werden sogar umfangreicher, wobei sie fremdbestimmte Züge annehmen.“
Levi zu lesen, ist immer lohnenswert. In diesem Fall helfen uns seine Reflexionen, wenn wir über unsere Erinnerungen nachdenken wollen: Inwiefern beeinflusst unsere eigene Geschichte unsere Identität, inwiefern schreiben wir diese Geschichte selbst, inwiefern beeinflussen andere unsere Geschichte und unseren Blick darauf? Was spart diese Geschichte aus, was verändert sich mit der Zeit, was kommt vielleicht sogar hinzu? Jede Handlung geschieht in einem Kontext, der sie beeinflusst. Das Wort „Kontext“ haben wir schon in den Wochen nach dem Terrorangriff oft gehört – und verschiedene Menschen haben sich dabei auf sehr unterschiedliche Inhalte bezogen. Ich beziehe mich hier aber zunächst nur auf den theoretischen Begriff: Jede Äußerung ist zeitlich und räumlich verankert und vollzieht sich entsprechend in einem komplexen Diskursraum, der sich nie vollständig umreißen lässt, auch nicht aus einer zeitlichen oder räumlichen Distanz.
Primo Levi, ausgebildeter Chemiker, gehört zu denen, die den Holocaust überlebt haben. Heute ist er als Schriftsteller im Gedächtnis, der nicht aufgehört hat, über den Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden nachzudenken. Was hätte er wohl heute zu sagen – nach dem 7. Oktober? Und ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023?
In Die Grauzone, ebenfalls erschienen 1986, schreibt Levi:
„Sind wir, die wir überlebt haben, imstande gewesen, unsere Erfahrung zu verstehen und verständlich zu machen? Wenn wir „verstehen“ sagen, meinen wir damit im Allgemeinen „vereinfachen“: ohne tiefgreifende Vereinfachung wäre die uns umgebende Welt ein unendliches, undefiniertes Durcheinander, das unserer Orientierungs- und Handlungsfähigkeit hohnsprechen würde.“
Levi sieht die Notwendigkeit der Vereinfachung, damit wir handlungsfähig bleiben und kommunizieren können. Aber er sieht gleichzeitig eine Gefahr:
„Wir neigen dazu, auch die Geschichte zu vereinfachen […]. Jedenfalls ist unser Bedürfnis […], die Welt in „wir“ und „sie“ aufzuteilen, dermaßen stark, dass dieses Schema einer Freund-Feind-Einteilung jedes andere überlagert. Die […] Geschichtsbetrachtung und die Geschichte, wie sie uns herkömmlicherweise in der Schule vermittelt wird, stehen unter dem Einfluss dieser […] Tendenz, die die Zwischentöne scheut und der Komplexität aus dem Weg geht. […] Dieser Wunsch nach Vereinfachung ist berechtigt, dagegen ist es die Vereinfachung selbst nicht immer.“
Im JMB wollen wir uns der Komplexität der Welt, des Zusammenlebens stellen. In Zeiten immer stärkerer Polarisierungen ist es wichtig, dass es Orte gibt, an denen wir fundiert und offen diskutieren können. Dazu gehört es, eine Vielfalt von Perspektiven zu hören und vielleicht sogar nachzuvollziehen. Nur das ermöglicht einen differenzierten Umgang, besonders mit sensiblen Themen wie denen, die wir behandeln. Das JMB will Gesprächen Raum geben und Vielfalt ernst nehmen. Es geht darum, Spannungen nicht zu übertünchen, sondern wahrzunehmen, sichtbar zu machen, zu erforschen, auszuhalten und zu verhandeln.
Die Erwartungshaltung, jede und jeder müsse sich zu allem schnell und eindeutig positionieren, ist verbreitet. Aber sie nimmt uns die Zeit zum Nachdenken – und verhindert vielleicht sogar, uns einzufühlen in die Position des Gegenübers. Wir müssen uns Zeit nehmen, einander zuzuhören, wenn wir miteinander sprechen. Und wir müssen darauf achten, welche Worte wir wählen, um nicht zu verletzen, welche Begriffe wir verwenden, um etwas treffend zu beschreiben, sie klar definieren, um nicht in die Falle derer zu tappen, die die Sprache für ihre Zwecke instrumentalisieren. Auch wenn in Deutschland kein Krieg herrscht – ganz ohne dass das unser Verdienst ist – so ist der Krieg in der Ukraine doch sehr nahe und der Krieg im Nahen Osten hat Auswirkungen auf das Leben in Deutschland.
Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland ist seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sprunghaft gestiegen – andere Länder vermelden das ebenfalls. Antisemitismus findet sich auch in der Mitte der Gesellschaft. Das machen die Diskussionen deutlich, die seit dem 7.10.2023 laufen.
Viel historisches Wissen, von dem wir annahmen, es sei verbreitet, fehlt Teilen der Bevölkerung – und zwar quer durch die Generationen und unabhängig davon, ob jemand eingewandert ist oder nicht.
Auch antisemitische Gewalt ist nicht neu, aber vor fünf Jahren hätte ich das Ausmaß der Bedrohung, der Jüdinnen und Juden in Deutschland gegenwärtig ausgesetzt sind, nicht für möglich gehalten. Die gesamte Gesellschaft ist beschädigt, wenn Angehörige von Minderheiten sich nicht sicher fühlen.
Noch einmal zitiere ich Primo Levi, Die Grauzone:
„Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.“
Hier liegt unsere Verantwortung als Zeitgenossen, als Bürger*innen in der Demokratie – und eine unserer Aufgaben als Jüdisches Museum Berlin: Wir müssen miteinander sprechen – und einander genau zuhören.
Bevor ich das Wort an Marina Chernivsky von OFEK e.V., die Organisatorin dieses Abends, übergebe, möchte ich noch einige Dankesworte aussprechen.
Eine solche Veranstaltung braucht viele unterstützende Köpfe und Hände. Natürlich stehen an erster Stelle Marina Chernivsky und ihr Team, die das Projekt „KOLOT – Stimmen. Perspektiven auf den 7. Oktober“, sowie den Abend heute und die Fachtagung morgen konzipiert und umgesetzt haben. Und ich danke dem Team des Jüdischen Museums Berlin, das die Veranstaltung begleitet hat.
In der anschließenden Diskussion gingen Expert*innen der Frage nach, wie diese Ereignisse unsere Gegenwarten prägen, welche Vergangenheiten dadurch aufgerissen werden, und wie Zukunftsentwürfe für jüdische und israelische Communities in Deutschland aussehen können. Zugleich erinnerte die Veranstaltung an den rechts-terroristischen Terroranschlag in Halle am 9. Oktober 2019.
KOLOT ist ein Projekt von OFEK e. V. in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin. Es wird ermöglicht durch die Förderung des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
Video-Mitschnitte: Vergangene Veranstaltungen ansehen (80)



 X
X