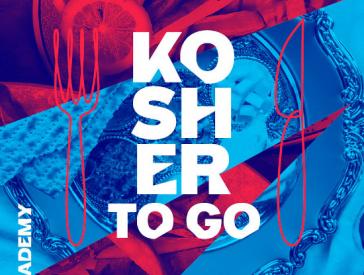Dialogische Ringvorlesung
(2015–2020)
Überblick über alle Vorlesungen mit Video-Mitschnitten
Von 2015 bis 2020 veranstalteten wir im Rahmen unseres Jüdisch-Islamischen Forums regelmäßig Ringvorlesungsreihen. Zu jeder Veranstaltung waren zwei Wissenschaftler*innen eingeladen, die das Thema aus jüdischer und islamischer Perspektive vorstellten und miteinander in einen Dialog traten.
Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die jeweiligen Reihen und finden alle Video-Mitschnitte einzelner Vorlesungen.
Der Glaube der Anderen. Weltreligionen im Spiegel von Judentum und Islam (2019/20)
Die Ringvorlesung lotet das vielschichtige Verhältnis von Judentum und Islam zu den anderen Religionen aus. Dabei geht es nicht nur um Christentum, Hinduismus und Buddhismus, sondern auch um das Verhältnis zum Atheismus sowie die theologische Beziehungsgeschichte von Judentum und Islam untereinander.
Zwischen traditionellen Überzeugungen und fortschreitender Säkularisierung stehen die Weltreligionen vor neuen Herausforderungen bezüglich der eigenen inneren Strukturen sowie in der Begegnung miteinander. Interreligiöse Beziehungen, ob auf individueller oder gesamtgesellschaftlicher Ebene, müssen neugedacht oder erstmalig definiert werden.
Video-Mitschnitte „Der Glaube der Anderen“
-
Auf dem Weg zur Erleuchtung – Judentum, Islam und Buddhismus. Mit Jerome Gellman (Ben Gurion Universität) und Johan Elverskog (Southern Methodist University), Video-Mitschnitt vom 24. Sep 2020, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Bund der Ehe versus Bund mit Gott – Juden und Muslime in interreligiösen Ehen. Mit Madeleine Dreyfus (Kulturanthropologin und Psychoanalytikerin) und Imen Gallala-Arndt (Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung), Video-Mitschnitt vom 18. Jun 2020, auf Deutsch
Mehr zur Veranstaltung -
Moral jenseits der Transzendenz – Judentum, Islam und Atheismus. Mit Jacques Berlinerblau (Georgetown University) und Ufuk Topkara (Johns Hopkins University), Video-Mitschnitt vom 20. Apr 2020, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Wie hältst du es mit Jesus? Judentum, Islam und Christentum. Mit Israel Yuval (Hebräische Universität Jerusalem) und Maha El Kaisy-Friemuth (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Video-Mitschnitt vom 18. Feb 2020, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Mono oder Poly? Judentum, Islam und Hinduismus. Mit Rabbiner Alon Goshen-Gottstein (Elijah Interfaith Institute) und Reza Shah-Kazemi (Institute of Ismaili Studies in London), Video-Mitschnitt vom 4. Feb 2020, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Judentum und Islam – eine theologische Beziehungsgeschichte. Mit Lukas Mühlethaler (Freie Universität Berlin) und Imam Abdullah Antepli (Duke University, USA), Video-Mitschnitt vom 21. Nov 2019, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Auf dem Weg zur Erleuchtung – Judentum, Islam und Buddhismus
Während Jüdinnen*Juden mit der Lehre Buddhas bis ins 19. Jahrhundert nur selten in Berührung kamen, hat die Verbreitung des Islams in Zentral- und Südostasien zu intensivem Austausch zwischen Muslim*innen und Buddhist*innen geführt. Wie gestalteten sich diese Beziehungen?
Heute erfreut sich der Buddhismus im Westen einer wachsenden Beliebtheit. Zu seinen Anhänger*innen gehören auch die sogenannten JuBus – vorwiegend amerikanische Jüdinnen*Juden, die buddhistischen Praktiken folgen. Wie ist dieses Interesse zu erklären? Und wie stehen Judentum und Islam heute einer Denktradition gegenüber, die Gottheiten kennt, nicht aber einen allmächtigen und unsterblichen Gott?
Es diskutieren Jerome Gellman (Ben Gurion Universität) und Johan Elverskog (Southern Methodist University), Video-Mitschnitt vom 24. Sep 2020, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Bund der Ehe versus Bund mit Gott – Juden und Muslime in interreligiösen Ehen
Liebe überwindet religiöse und kulturelle Schranken – so jedenfalls glauben viele Menschen. Die steigende Zahl interreligiöser Ehen in Europa und Amerika scheint dies auch zu bestätigen. Doch im Alltag stellen sich Paaren, die nicht den gleichen Glauben praktizieren, einige Herausforderungen.
Wie gehen Jüdinnen*Juden und Muslim*innen damit um? Wie lässt sich eine Balance zwischen den eigenen und den religiösen Überzeugungen des*der Partner*in finden – und an Kinder weitergeben? Und schließlich wie reagieren die religiösen Autoritäten auf die interkonfessionellen Ehen?
Es diskutieren Madeleine Dreyfus (Kulturanthropologin und Psychoanalytikerin) und Imen Gallala-Arndt (Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung). Das Gespräch moderiert Alina Gromova, Jüdisches Museum Berlin, Video-Mitschnitt vom 18. Jun 2020, auf Deutsch
Mehr zur Veranstaltung
Moral jenseits der Transzendenz – Judentum, Islam und Atheismus
Zweifel und Kritik – die Veranstaltung widmet sich der Frage, inwiefern atheistische und religionskritische Denkweisen für eine zeitgemäße jüdische und islamische Theologie heute konstruktiv sein können.
Skeptizismus, Unglaube und Zweifel begleiten die Religionen seit ihren Anfängen. In Folge der fortschreitenden Säkularisierung haben sich atheistische und agnostische Überzeugungen jedoch in einem bisher unbekannten Maß in der westlichen Welt verbreitet. Wie reagieren Judentum und Islam darauf?
Es diskutieren Jacques Berlinerblau (Georgetown University) und Ufuk Topkara (Johns Hopkins University), Video-Mitschnitt vom 20. Apr 2020, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Wie hältst du es mit Jesus? Judentum, Islam und Christentum
Dreifaltigkeit, Heiligenverehrung und Jesus als Sohn Gottes – viele christliche Überzeugungen und Glaubenspraktiken stoßen bei Jüdinnen*Juden und Muslim*innen auf Unverständnis. Der Glaube an den Schöpfergott und die Unsterblichkeit der Seele sowie die Achtung moralischer Prinzipien werden dagegen positiv gesehen.
In dieser Veranstaltung geht es um jüdische und muslimische Perspektiven auf das Christentum. Worin ähneln sich diese Perspektiven und wo gehen sie auseinander? Und wie wird die Vielfalt der christlichen Konfessionen in theologischen Debatten wahrgenommen?
Es diskutieren Israel Yuval (Hebräische Universität Jerusalem) und Maha El Kaisy-Friemuth (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Video-Mitschnitt vom 18. Feb 2020, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Mono oder Poly? Judentum, Islam und Hinduismus
Wie blicken Jüdinnen*Juden und Muslim*innen heute auf den Hinduismus, der von der Existenz mehrerer Gottheiten ausgeht? Die Abgrenzung von polytheistischen Religionsformen und dem „Götzendienst“ hat das Judentum seit der Antike geprägt. Auch der Islam hatte in seiner Geschichte zahlreiche Erfahrungen mit nicht-monotheistischen Religionen – schon zur Zeit seiner Entstehung im frühen 7. Jahrhundert und auch während seiner Expansion in Asien.
Es steht zur Diskussion, ob die historischen Perspektiven für das heutige Verständnis von polytheistischen Religionen hilfreich sind oder einer differenzierten Auseinandersetzung eher hinderlich.
Es diskutieren Rabbiner Alon Goshen-Gottstein (Elijah Interfaith Institute) und Reza Shah-Kazemi (Institute of Ismaili Studies in London), Video-Mitschnitt vom 4. Feb 2020, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Judentum und Islam – eine theologische Beziehungsgeschichte
Das Judentum wird gemeinhin als die erste monotheistische Religion betrachtet. Mit dem Aufkommen des Islams entstand dem Judentum jedoch eine strikt monotheistische „Konkurrenz“.
Wie betrachteten die jüdischen Gelehrten diese neue Religion? Sowohl der Koran als auch frühislamische Schriften zeugen von zahlreichen Begegnungen zwischen dem Propheten Mohammed und Jüdinnen*Juden.
Wie äußert sich die Heilige Schrift der Muslim*innen und die frühe muslimische Überlieferung über Jüdinnen*Juden und ihre religiösen Vorstellungen und Praktiken?
Es diskutieren Lukas Mühlethaler (Freie Universität Berlin) und Imam Abdullah Antepli (Duke University, USA), Video-Mitschnitt vom 21. Nov 2019, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Wissen und Glauben in Judentum und Islam (2018/19)
Wissenschaftliche Entdeckungen auf dem Gebiet der Astronomie, Geologie und Biologie haben in den letzten Jahrhunderten das Selbstverständnis des Menschen als Mittelpunkt und „Krone der Schöpfung“ in Frage gestellt. Heute stehen sich religions- und wissenschaftsfeindliche Positionen oft unversöhnlich gegenüber.
Das gegenwärtig zwiespältige Verhältnis von Religion und Wissenschaft war in der Vergangenheit über lange Zeit keinesfalls dominierend. Zahlreiche Theolog*innen waren zugleich Naturwissenschaftler*innen und lieferten bedeutende Beiträge zu unserem Verständnis der Welt und des Menschen.
Das Ziel dieser Vorlesungsreihe ist es daher, das spannungsreiche Verhältnis von Judentum und Islam zu den Wissenschaften auszuloten. Der oben genannten Konflikterzählung sollen andere Narrative zur Seite gestellt werden, die von einer vielschichtigen und intensiven Auseinandersetzung mit den Wissenschaften in beiden Theologien zeugen.
Video-Mitschnitte „Wissen und Glauben in Judentum und Islam“
-
Glauben Sie an Wunder? Mit James A. Diamond (Professor für Jüdische Studien an der University of Waterloo, Kanada) und Umeyye Isra Yazicioglu (Professorin für Religionswissenschaft an der St. Joseph’s University in Philadelphia, USA), Video-Mitschnitt vom 13. Jun 2019, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Der Mensch zwischen Freiheit und Schicksal. Mit Alan Mittleman (Jewish Theological Seminary of America) und Martin Mahmud Kellner (Institut für Islamische Theologie, Osnabrück), Video-Mitschnitt vom 30. Apr 2019, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Wie viel Gott ist in den heiligen Schriften? Mit Benjamin Sommer (Experte für moderne jüdische Theologie) und Ghassan el Masri (Forscher über den Koran im Kontext der arabischen Literatur seiner Zeit), Video-Mitschnitt vom 5. Mär 2019, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Gott, Darwin und die Evolution. Mit Natan Slifkin (Autor und Gründungsdirektor des Biblischen Museums für Naturgeschichte in Beit Shemesh, Israel) und Fatimah Jackson (Howard University, USA), Video-Mitschnitt vom 31. Jan 2019, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Wissenschaft im Zeichen des Glaubens. Mit Geoffrey A. Mitelman (Sinai and Synapses) und Ahmad S. Dallal (Georgetown University, Qatar), Video-Mitschnitt vom 20. Nov 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Glauben Sie an Wunder?
Jüdische und islamische Theologen haben über Jahrhunderte das Spannungsfeld zwischen dem Glauben an Gott und seine Offenbarung sowie der menschlichen Vernunft reflektiert. Sie haben entweder der Vernunft gegenüber der Offenbarung Vorrang eingeräumt oder aber die Offenbarung als die letztgültige Instanz verstanden.
Wie hat sich die Verhältnisbestimmung zwischen Vernunft und Glaube in der Geschichte entwickelt und wie sieht sie heute angesichts des rasanten naturwissenschaftlichen Fortschrittes aus?
Es diskutieren James A. Diamond (Professor für Jüdische Studien an der University of Waterloo, Kanada) und Umeyye Isra Yazicioglu (Professorin für Religionswissenschaft an der St. Joseph’s University in Philadelphia, USA), Video-Mitschnitt vom 13. Jun 2019, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Der Mensch zwischen Freiheit und Schicksal
Die Annahme, Gott sei allmächtig und allwissend, steht in einem Spannungsverhältnis zur Auffassung von der Willensfreiheit des Menschen. Es geht dabei um nicht weniger als die Verantwortung des Menschen für sein eigenes Handeln – eine Frage, die jüdische und islamische Gelehrte seit jeher beschäftigt.
Die Fähigkeit des Menschen zur bewussten Entscheidung wird durch neue Erkenntnisse der Psychologie sowie der Hirn- und Genforschung immer stärker in Frage gestellt. Der Mensch sei von biochemischen Prozessen und seiner genetischen Disposition her bestimmt.
Ist der Mensch frei oder ist unsere Willensfreiheit nur eine Illusion?
Es diskutieren Alan Mittleman (Jewish Theological Seminary of America) und Martin Mahmud Kellner (Institut für Islamische Theologie, Osnabrück), Video-Mitschnitt vom 30. Apr 2019, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Wie viel Gott ist in den heiligen Schriften?
Die Tora und der Koran sind für gläubige Jüdinnen*Juden und Muslim*innen heilige Schriften, die Gottes Wort beinhalten. Die Methode der historisch-kritischen Forschung ermöglicht, die Entstehung beider Schriften aus ihrem jeweiligen historischen Kontext heraus zu erklären. Die Entzifferung altorientalischer Texte hat beispielsweise die Abhängigkeit vieler biblischer und koranischer Motive und Vorschriften von antiken Traditionen aufgezeigt. Dies wird nicht selten als Herausforderung für die Lehre vom göttlichen Ursprung der Heiligen Schriften verstanden.
Lassen sich historische Textforschung und religiöse Überzeugungen vereinbaren?
Es diskutieren Benjamin Sommer (Experte für moderne jüdische Theologie) und Ghassan el Masri (Forscher über den Koran im Kontext der arabischen Literatur seiner Zeit), Video-Mitschnitt vom 5. Mär 2019, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Gott, Darwin und die Evolution
Judentum und Islam haben für die Entstehung der Welt und den Ursprung des Menschen theologische Erklärungen. Sie künden von einem Gott, der die Welt und alle Lebewesen in einem Schöpfungsakt erschaffen und dem Menschen eine herausgehobene Stellung darin zugewiesen hat. Die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie weisen jedoch nach, dass alle lebenden Organismen von anderen Organismen abstammen und damit auch die Menschen letztlich das Ergebnis eines über Millionen Jahre andauernden Evolutionsprozesses sind.
Wie werden diese naturwissenschaftlichen Zugänge im Rahmen der Theologie aufgegriffen?
Es diskutieren Natan Slifkin (Autor und Gründungsdirektor des Biblischen Museums für Naturgeschichte in Beit Shemesh, Israel) und Fatimah Jackson (Howard University, USA), Video-Mitschnitt vom 31. Jan 2019, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Wissenschaft im Zeichen des Glaubens
Jüdische und islamische Theologen haben über Jahrhunderte das Spannungsfeld zwischen dem Glauben an Gott und seine Offenbarung sowie der menschlichen Vernunft reflektiert. Sie haben entweder der Vernunft gegenüber der Offenbarung Vorrang eingeräumt oder aber die Offenbarung als die letztgültige Instanz verstanden.
Wie hat sich die Verhältnisbestimmung zwischen Vernunft und Glaube in der Geschichte entwickelt und wie sieht sie heute angesichts des rasanten naturwissenschaftlichen Fortschrittes aus?
Es diskutieren Geoffrey A. Mitelman (Sinai and Synapses) und Ahmad S. Dallal (Georgetown University, Qatar), Video-Mitschnitt vom 20. Nov 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Jüdische und islamische Perspektiven auf Menschenrechte (2017/18)
Seit der Deklaration der Menschenrechte von 1948 gelten die dort verankerten Prinzipien als ein universelles Wertesystem. Es erhebt den Anspruch, eine moralische Grundlage sowohl für die internationale Gemeinschaft als auch für die einzelnen Staaten zu bilden. In der Theorie garantiert die Idee der Menschenrechte allen Religionen und Weltanschauungen ihren gleichberechtigten Platz. Da sie jedoch im christlich-europäischen Kontext formuliert wurde, gibt es auch Kritik an ihrem universalen Anspruch. Die Ringvorlesung fragt daher, wie Judentum und Islam die Menschenrechte innerhalb ihrer religiösen Traditionen auslegen.
Expert*innen beider Religionen setzen sich mit der Frage auseinander, ob und auf welche Weise konkrete Menschenrechte wie das Recht auf Leben, auf Meinungsfreiheit, auf Geschlechtergerechtigkeit und auf Religionsfreiheit innerhalb ihrer Religionen theologisch begründet und in der Praxis umgesetzt werden können.
Video-Mitschnitte „Jüdische und islamische Perspektiven auf Menschenrechte“
-
Mein Gott, dein Gott, kein Gott. Mit Leora Batnitzky (Princeton University) und Anver Emon (University of Toronto), Video-Mitschnitt vom 14. Jun 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Gleich vor Gott und den Menschen? Mit Susannah Heschel (Dartmouth College) und Katajun Amirpur (Universität Hamburg), Video-Mitschnitt vom 3. Mai 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Wie viel Kritik vertragen Judentum und Islam? Mit Suzanne Last Stone (Yeshiva University) und Anshuman Mondal (University of East Anglia), Video-Mitschnitt vom 12. Apr 2018, auf Englisch und Deutsch
Mehr zur Veranstaltung -
Das Recht auf Leben. Mit David Novak (University of Toronto) und Jonathan Brown (Georgetown University), Video-Mitschnitt vom 8. Mär 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Menschenrechtsabkommen und ihre Rezeption. Mit Michael Galchinsky (Georgia State University) und Mashood Baderin (University of London), Video-Mitschnitt vom 25. Jan 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Menschenrechte und Religionen – ein Widerspruch? Mit Sardar Ali (University of Warwick) und Jill Jacobs (Rabbinerin und Direktorin von T´ruah: The Rabbinic Call for Human Rights), Video-Mitschnitt vom 23. Nov 2017, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Mein Gott, dein Gott, kein Gott
Religionsfreiheit umfasst die Freiheit, die eigene Glaubensüberzeugung zu bestimmen und die gewählte Religion auszuüben – aber auch das Recht, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören.
Wie positionieren sich Judentum und Islam im Spannungsfeld zwischen individueller Gewissensfreiheit und dem absoluten Wahrheitsanspruch der eigenen Religion? Wie gehen sie damit um, wenn ihre Anhänger*innen die Religionsgemeinschaft verlassen und wie werden Andersgläubige betrachtet und behandelt?
Es diskutieren Leora Batnitzky (Princeton University) und Anver Emon (University of Toronto), Video-Mitschnitt vom 14. Jun 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Gleich vor Gott und den Menschen?
Religionen trifft vielfach der Vorwurf, dass ihre patriarchalisch geprägten Strukturen und Traditionen keinen Platz für Emanzipation lassen.
Wie stehen gläubige Jüdinnen und Musliminnen zu Vorschriften, die ihnen den Zugang zu religiösen Ämtern verwehren, ihr Zeugnis vor Gericht nicht als vollwertig betrachten und ihnen das Recht auf Scheidung absprechen? Lässt sich aus ihren religiösen Traditionen eine jüdische und muslimische Geschlechtergerechtigkeit ableiten, die ein emanzipatives Verständnis religiöser Lebensweise ermöglicht?
Es diskutieren Susannah Heschel (Dartmouth College) und Katajun Amirpur (Universität Hamburg), Video-Mitschnitt vom 3. Mai 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Wie viel Kritik vertragen Judentum und Islam?
Offener Meinungsaustausch ist das Fundament politischer und geistiger Freiheit und schließt die Kritik an religiösen Inhalten und Institutionen mit ein. Historisch betrachtet blicken Judentum und Islam auf eine Debattenkultur zurück, in der Meinungsvielfalt gefördert wurde.
Wie viel interne und externe Religionskritik tolerieren Judentum und Islam heute?
Es diskutieren Suzanne Last Stone (Yeshiva University) und Anshuman Mondal (University of East Anglia), Video-Mitschnitt vom 12. Apr 2018, auf Englisch und Deutsch
Mehr zur Veranstaltung
Das Recht auf Leben
Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist die Grundlage jeder freien Gesellschaft. Dennoch wird dieses Recht in vielen Staaten massiv eingeschränkt und missachtet: Unter Berufung auf die Scharia werden in einigen muslimischen Staaten Folter-, Prügel- und Todesstrafen gerechtfertigt.
Im „Krieg gegen den Terror“ werden Folter und gezielte Tötungen ohne Gerichtsverfahren legitimiert. Unter welchen Bedingungen darf im Judentum und Islam das Recht auf Leben eines Menschen eingeschränkt werden und wie wird dieses Recht gegenüber anderen Rechtsgütern abgewogen?
Es diskutieren David Novak (University of Toronto) und Jonathan Brown (Georgetown University), Video-Mitschnitt vom 8. Mär 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Menschenrechtsabkommen und ihre Rezeption
Seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 haben jüdische und muslimische Jurist*innen und Intellektuelle an weiteren Menschenrechtsverträgen und Erklärungen mitgewirkt, die spezifisch regionalen oder nationalen Charakter haben.
Welche religiösen und ethischen Normen liegen diesen Verträgen zu Grunde? Und wie gestaltet sich der zeitgenössische jüdische und muslimische Diskurs über die Adaptierung und praktische Umsetzung von Menschrechten außerhalb von Europa und Nordamerika?
Es diskutieren Michael Galchinsky (Georgia State University) und Mashood Baderin (University of London), Video-Mitschnitt vom 25. Jan 2018, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Menschenrechte und Religionen – ein Widerspruch?
Menschenrechte gelten als säkulares Wertesystem, das in der christlichen Tradition verwurzelt universelle Geltung beansprucht.
Dabei haben auch jüdische und islamische Traditionen über Jahrhunderte ethische Maßstäbe entwickelt, die für ihre Anhänger*innen verbindlich sind. Wo bestehen Spannungsfelder zwischen diesen Normen? Wo liefern Judentum und Islam Anknüpfungspunkte an einen zeitgenössischen Menschenrechtsdiskurs oder besteht gar eine Unvereinbarkeit zwischen beiden?
Es diskutieren Sardar Ali (University of Warwick) und Jill Jacobs (Rabbinerin und Direktorin von T´ruah: The Rabbinic Call for Human Rights), Video-Mitschnitt vom 23. Nov 2017, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Ethische Fragen in Judentum und Islam (2016/17)
Infolge des rasanten technologischen Fortschritts, der gesellschaftlichen Pluralisierung und der Globalisierung werden moderne Gesellschaften vor neue ethische Herausforderungen gestellt. Im Zentrum vieler Debatten stehen ethische Probleme, die sowohl den öffentlichen Raum als auch die Privatsphäre jedes Einzelnen betreffen und die für Gesellschaft, Politik oder Wirtschaft relevant sind. Die Ringvorlesung greift daher ethisch brisante Themen aus unterschiedlichen Lebensbereichen auf und beleuchtet sie aus jüdischer und islamischer Perspektive. Es geht dabei um die Fragen, ob es eine gemeinsame Richtschnur für jüdische und islamische ethische Positionen gibt, und inwieweit sich die Vielfalt der Überzeugungen in einen gemeinsamen, normativen Rahmen einer modernen Gesellschaft integrieren lässt.
Video-Mitschnitte „Ethische Fragen in Judentum und Islam“
-
Der Mensch als Herr oder Hüter der Schöpfung? Mit Hava Tirosh-Samuelson (Arizona State University in Tempe) und Nawal Ammar (Rowan University in New Jersey), Video-Mitschnitt vom 13. Jul 2017, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Sexualethik: Sexualität, Lust, Erotik und Gott. Mit David Biale (Eros and the Jews) und Kecia Ali (Sexual Ethics and Islam), Video-Mitschnitt vom 16. Mai 2017, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Militärethik - Unter den Waffen schweigen die (Religions-)Gesetze? Mit Michael Broyde (Emory University) und Asma Afsaruddin (Indiana University), Video-Mitschnitt vom 6. Apr 2017, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Grenzen des Lebens - Bioethische Fragen. Mit Laurie Zoloth (Weinberg College, Northwestern University) und İlhan İlkılıç (Universität Istanbul), Video-Mitschnitt vom 23. Feb 2017, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Wirtschaftsethik: Ist Kapitalismus koscher/halal? Mit Nathan Lee Kaplan (Autor) und Idris Nassery (Universität Paderborn), Video-Mitschnitt vom 8. Dez 2016, auf Deutsch
Mehr zur Veranstaltung -
Sozialethik: Über eine gerechte Gesellschaftsordnung. Mit Ingrid Mattson (Western University, Kanada) und Micha Brumlik (Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg), Video-Mitschnitt vom 26. Okt 2016, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Der Mensch als Herr oder Hüter der Schöpfung?
Lange wurde der Vorwurf erhoben, die abrahamitische Tradition habe eine massive Mitschuld an der ökologischen Krise, basierend auf der Aufforderung Gottes, sich die Erde untertan zu machen.
Kann aber die Ausbeutung der Natur tatsächlich den Religionen zur Last gelegt werden? Welche Positionen lassen sich aus jüdischer und muslimischer Ethik zur Legitimität von Eingriffen in die Natur ableiten, beispielsweise in Bezug auf die Züchtung genetisch veränderter Organismen oder Climate Engineering?
Es diskutieren Hava Tirosh-Samuelson (Arizona State University in Tempe) und Nawal Ammar (Rowan University in New Jersey), Video-Mitschnitt vom 13. Jul 2017, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Sexualethik: Sexualität, Lust, Erotik und Gott
Jüdische und muslimische Sexualmoral galten in der westlichen Gesellschaft lange als besonders liberal, heute dominieren in der westlichen Imagination dagegen Vorstellungen von sehr repressiver religiöser Moral, die Sexualität unterdrückt.
Was sagen aber Judentum und Islam über das sexuelle Leben und über Erotik? Welche Standpunkte werden bei kontroversen Themen wie Sexualerziehung, Polygamie, Homosexualität und Pornographie vertreten?
Es diskutieren David Biale (Eros and the Jews) und Kecia Ali (Sexual Ethics and Islam), Video-Mitschnitt vom 16. Mai 2017, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Militärethik - Unter den Waffen schweigen die (Religions-)Gesetze?
Wie halten wir es mit den Kriegsdrohnen? Gibt es ethische Grenzen, die man selbst bei der Bekämpfung von Terrorismus nicht überschreiten darf?
Der technologische Fortschritt in den letzten Jahrzehnten wirft eine Reihe von neuen Fragen nach erlaubten und unerlaubten Waffen (Killer-Roboter, biologische Waffen) und nach Risiken und Chancen von militärischen Interventionen auf.
In der Diskussion geht es um die jüdische und muslimische Haltung gegenüber solchen Herausforderungen sowie um die grundlegende Frage nach der Anwendung kriegerischer Gewalt.
Es diskutieren Michael Broyde (Emory University) und Asma Afsaruddin (Indiana University), Video-Mitschnitt vom 6. Apr 2017, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Grenzen des Lebens - Bioethische Fragen
Durch den Fortschritt von Biotechnologie und Medizin werden sowohl säkulare wie religiöse Gemeinschaften mit Fragen konfrontiert, die das Selbstverständnis des Menschen und seine traditionellen Werte herausfordern.
Jüdische und muslimische Haltungen zu Behandlungsmethoden der Reproduktionsmedizin, zu Stammzellenforschung, Gentherapie und Sterbehilfe berühren die großen existenziellen Fragen nach Beginn und Ende des Lebens sowie nach der Würde und dem Sinn der menschlichen Existenz.
Es diskutieren Laurie Zoloth (Weinberg College, Northwestern University) und İlhan İlkılıç (Universität Istanbul), Video-Mitschnitt vom 23. Feb 2017, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Wirtschaftsethik: Ist Kapitalismus koscher/halal?
Gewinn und Geld werden oft negativ assoziiert. Materieller Reichtum und Profitstreben erscheinen vielen als Gegensatz zu einem spirituellen und religiösen Leben.
Wie werden aber aus jüdischer und muslimischer Perspektive materieller Besitz und Reichtum tatsächlich bewertet? Judentum und Islam stellen Gebote und Verbote auf, die das ökonomische Handeln zu regeln versuchen. Können solche religiös begründeten Normen konkrete Impulse für eine ethisch gedachte Wirtschaft liefern und in einer modernen Marktwirtschaft umgesetzt werden?
Es diskutieren Nathan Lee Kaplan (Autor) und Idris Nassery (Universität Paderborn), Video-Mitschnitt vom 8. Dez 2016, auf Deutsch
Mehr zur Veranstaltung
Sozialethik: Über eine gerechte Gesellschaftsordnung
Im Judentum und im Islam ist die Aufforderung an die Gläubigen, Gerechtigkeit zu üben, zentral. Sie wird jedoch nicht nur als individuelle Tugend gedacht, sondern auch als eine Grundnorm, die das gesellschaftliche Leben gestalten soll. Ingrid Mattson, Professorin für Islamwissenschaft am Huron College der Western University in Kanada, und Micha Brumlik, Senior Advisor am Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, diskutieren, wie Judentum und Islam eine gerechte Gesellschaft konzipieren und welche Bedingungen und Normen sie erfüllen muss, um diesem Ideal zu entsprechen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht dabei die Frage nach den konkreten Gesellschaftssystemen, die ihm am nächsten kommen dürften.
Es diskutieren Ingrid Mattson (Western University, Kanada) und Micha Brumlik (Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg), Video-Mitschnitt vom 26. Okt 2016, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Judentum & Islam in der Diaspora (2015/16)
Während die Diaspora prägend ist für das Judentum, sehen sich Muslim*innen spätestens seit der postkolonialen Migration nach Westeuropa und in andere westliche Staaten verstärkt mit Fragestellungen zur religiösen Alltagspraxis in einer Minderheitensituation konfrontiert.
Die Ringvorlesung beleuchtet die damit verbundenen theologischen Debatten, in denen das Spannungsverhältnis zwischen Eigenständigkeit und Anpassung ausgelotet wird. Im Zentrum der Aushandlungsprozesse zwischen Tradition und Moderne stehen Fragen der rechtlichen Auslegungen sowie religiöser Praxis. Dazu gehören das Familienrecht, rituelle Speisevorschriften, Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen religiöser Identitäten und Neuinterpretationen zu Geschlechterfragen.
Video-Mitschnitte „Judentum & Islam in der Diaspora“
-
Was heißt Diaspora für Juden und Muslime? Mit Michael L. Satlow (Brown University in Providence) und Sarah Albrecht (Freie Universität Berlin), Video-Mitschnitt vom 29. Okt 2015, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Religiöses Recht und säkularer Staat. Mit Ronen Reichman (Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg) und Mathias Rohe (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg), Video-Mitschnitt vom 9. Dez 2015, auf Deutsch
Mehr zur Veranstaltung -
Wie wird man Jude? Wie wird man Muslim? Mit Tobias Jona Simon (Rabbiner des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachen) und Esra Özyürek (European Institute der London School of Economics), Video-Mitschnitt vom 18. Feb 2016, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung -
Feministische Zugänge zu Judentum und Islam. Mit Judith Plaskow (Religionswissenschaftlerin und Autorin) und Ziba Mir-Hosseini, die zu islamischem Recht und Gender forscht, Video-Mitschnitt vom 14. Apr 2016, auf English
Mehr zur Veranstaltung -
Bio trifft auf koscher und halal. Mit Es diskutieren: Shai Lavi (Tel Aviv University) und Sarra Tlili (University of Florida), Video-Mitschnitt vom 1. Jun 2016, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Was heißt Diaspora für Juden und Muslime?
Die Existenz von Jüd*innen in der Diaspora war schon seit der Formierung der Religion eine gelebte Realität. Anders in der Geschichte des Islams, wo ein dauerhaftes Leben unter nichtmuslimischer Herrschaft anfänglich nicht unbedingt vorgesehen war.
Es diskutieren Michael L. Satlow (Brown University in Providence) und Sarah Albrecht (Freie Universität Berlin), Video-Mitschnitt vom 29. Okt 2015, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Religiöses Recht und säkularer Staat
Auch in christlich geprägten, säkularen Staaten wie in Westeuropa kann in begrenztem Umfang jüdisches bzw. islamisches Recht zur Anwendung kommen. Dies betrifft in erster Linie Fragen des Familien- und Erbrechts.
Welche Möglichkeiten und Grenzen hat die religiöse Rechtsprechung in Ländern wie Deutschland? Wo liegen gesellschaftliche Konfliktpotenziale? Und inwieweit wirkt die Diasporasituation ihrerseits auf die Auslegung jüdischen und islamischen Rechts ein?
Es diskutieren Ronen Reichman (Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg) und Mathias Rohe (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg), Video-Mitschnitt vom 9. Dez 2015, auf Deutsch
Mehr zur Veranstaltung
Wie wird man Jude? Wie wird man Muslim?
Die Grenzen von Religionsgemeinschaften sind fluide und werden immer wieder neu definiert. Eine mögliche Grenzüberschreitung von außen nach innen ist die Konversion. Während der Islam um neue Gläubige wirbt, steht das Judentum Konversionen eher zurückhaltend gegenüber.
Es diskutieren Tobias Jona Simon (Rabbiner des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachen) und Esra Özyürek (European Institute der London School of Economics), Video-Mitschnitt vom 18. Feb 2016, auf Deutsch und Englisch
Mehr zur Veranstaltung
Feministische Zugänge zu Judentum und Islam
Religion und Feminismus, das scheint ein unüberwindbarer Widerspruch zu sein. Dennoch lässt sich die Herausbildung religiös begründeter Ansätze beobachten, die ihren Fokus auf eine Re-Lektüre religiöser Schriften aus feministischer Perspektive richten.
Welche Konfliktlinien bestehen zwischen den traditionellen Lesarten und den Neuinterpretationen und wie nehmen die Religionsgemeinschaften diese innovativen Zugänge wahr?
Es diskutieren Judith Plaskow (Religionswissenschaftlerin und Autorin) und Ziba Mir-Hosseini, die zu islamischem Recht und Gender forscht, Video-Mitschnitt vom 14. Apr 2016, auf English
Mehr zur Veranstaltung
Bio trifft auf koscher und halal
Judentum und Islam werden in ihrem Umgang mit Nutztieren oft kritisch beäugt. Besonders das Schächten wird von der nicht-jüdischen und nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft häufig als moralisch verwerflich angesehen.
Es diskutieren Shai Lavi (Tel Aviv University) und Sarra Tlili (University of Florida), Video-Mitschnitt vom 1. Jun 2016, auf Englisch
Mehr zur Veranstaltung



 X
X

 X
X

 X
X

 X
X

 X
X